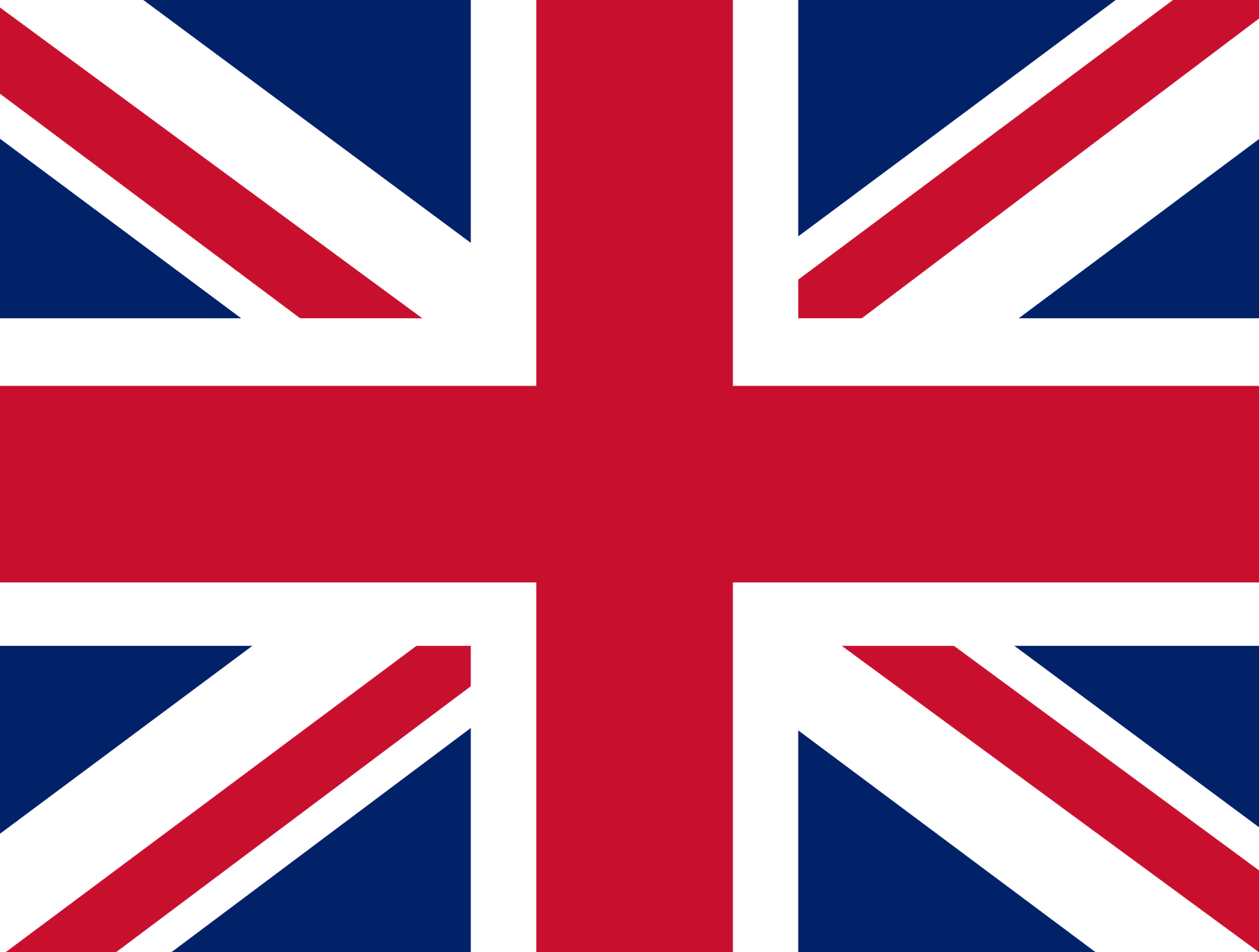
Vereinigtes Königreich
Das terroristische Bedrohungsbild für das Vereinigte Königreich ist vielschichtig, dynamisch, anhaltend und wandelbar. Nationale Nachrichtendienste und die Joint Terrorism Analysis Centre beobachten parallel mehrere Kategorien: international inspirierte beziehungsweise organisierte islamistische Gewalt, extrem rechte Gewalt, gewaltbereite Gruppierungen im Kontext Nordirlands sowie hybride/entsendungs- und staatlich unterstützte Bedrohungen. Seit der letzten umfassenden Strategie-Revision (CONTEST 2023) wurden in jüngerer Vergangenheit mehrere Anschläge verübt und zahlreiche „late-stage“-Plots verhindert; die Behörden betonen, dass die Gefährdung zunehmend unvorhersehbar wird und sich die Methoden (z. B. Fahrzeug- oder Messerangriffe, Kleinstsprengsätze, koordinierte Mehrtäteraktionen) diversifizieren.
Transnationale Dimensionen bestehen in
(a) Rückkehrern und ausländischen Kämpfern, die Ausbildung, Kampferfahrung oder Netzwerke mitbringen können;
(b) Online-Radikalisierung und Fremd-Inspirationskanälen, die grenzüberschreitend wirken; und
(c) gezielten Beeinflussungs- und Sabotageaktivitäten durch feindliche Staaten, die das Sicherheitsumfeld zusätzlich komplizieren. Die Sicherheitsarchitektur ist darauf ausgelegt, ideologieübergreifend (threat-agnostic) zu arbeiten, da Motivation und Taktik sich rasch verschieben können.
Hauptzielobjekte sind öffentlich zugängliche Orte mit hoher Personendichte (Verkehrsknoten, Einkaufszentren, Veranstaltungsorte, religiöse Einrichtungen), kritische Infrastruktur (Energie, Transport, Gesundheitswesen, Nuklearanlagen) sowie symbolträchtige Einrichtungen (Regierungsgebäude, Diplomatenviertel).
Städtische Gebiete weisen erhöhte Risiken durch Dichte, Mobilität und hohe Sichtbarkeit auf: schnelleres Entstehen von Opferszenarien, schwierigeres Lagebild und größere Medien-/politische Wirkung. Ländliche Räume sind weniger wahrscheinlich Ziele für Massenzwischenfälle, tragen aber andere Verwundbarkeiten — etwa weiträumige Verkehrsinfrastruktur, isolierte Versorgungsanlagen oder Orte mit niedriger Polizeipräsenz, die für logistische Vorbereitung oder Anschläge mit längerer Wirksamkeit attraktiv sein können. Nordirland und grenznahe Gebiete unterscheiden sich strukturell: hier sind dissidente republikanische oder loyalistische Gruppierungen weiterhin relevant und operieren mit anderen Netzwerken und Taktiken als die in England/Wales dominierenden Bedrohungsformen.
Angriffsarten reichen von Low-Tech-Einzelangriffen (Fahrzeug- und Messerattacken, Störungen durch Brandstiftung) über improvisierte Sprengsätze bis hin zu komplexeren koordinierten Operationen und Cyber-/sabotagegestützten Angriffen auf Versorgungsketten. Bei bestimmten Sektoren (z. B. zivile Nuklearinfrastruktur) bestehen spezielle Schutzmaßnahmen und spezialisierte Polizeikräfte.
Behörden führen Personen zurückgebrachte Kampferfahrung, Netzwerke oder Kontakte zu ausländischen Extremisten zu. Parallel ist die lokale Rekrutierung — vor allem online und in spezifischen Community-Milieus — weiterhin präsent; deswegen wird das präventive Case-Management (Prevent/Channel) in Schulen, Gesundheits- und Gemeindediensten eingesetzt. Statistiken zu Prevent-Zuweisungen zeigen andauernde hohe Fallzahlen, die eine dauerhafte Belastung für lokale Präventionsstrukturen darstellen. Insgesamt variiert das Risiko individuell stark (von marginaler Radikalisierung bis zu Personen mit operativem Potenzial), weshalb behördenübergreifende Fallbewertung und Informationsaustausch zentral sind.
Das Vereinigte Königreich betreibt ein mehrschichtiges Schutzsystem: strategisch durch die CONTEST-Strategie (four-Pillar-Ansatz: Prevent, Pursue, Protect, Prepare), operativ durch Counter Terrorism Policing in enger Zusammenarbeit mit MI5, Geheimdienstpartnern und lokalen Polizeikräften.
In den letzten Jahren wurden Gesetze und Legislativvorschläge (z. B. Schutzvorschriften für öffentliche Räume, Aktualisierungen im Crime & Policing-Bereich) erarbeitet, um rechtliche Befugnisse, Präventionsinstrumente und Schutzanforderungen an moderne Bedrohungen anzupassen. Grenz- und Reiseüberwachung, Informationsaustausch mit internationalen Partnern und multilaterale Kooperationen (Polizei, Geheimdienste, EU/US-Partner) sind integrale Bestandteile zur Früherkennung und Störung grenzüberschreitender Netzwerke.
Operativ ist die Polizei für bewaffnete Interventionen und Sofortmaßnahmen gerüstet; die Zahl der autorisierten Einsatzkräfte mit Schusswaffen wird statistisch erfasst und zeigt leichte jährliche Schwankungen, was Auswirkungen auf Verfügbarkeit und Reaktionskapazität in Spitzenlagen haben kann. Gleichzeitig arbeiten spezialisierte Schutzkräfte (z. B. zivil-nukleare Schutzpolizei) und private Betreiber enger zusammen, um kritische Standorte zu sichern.
Im Bereich Vorbereitung und Reaktion ist das Gesundheitswesen (NHS) formal in nationale EPRR-(Emergency Preparedness, Resilience & Response)-Strukturen eingebunden: es gibt Vorgaben für Mass casualty management, regional koordinierte Versorgungsketten, sowie regelmäßige Assurance-Berichte und Übungen, um Skalierbarkeit und Reserven zu prüfen.
Lokale Notfallpläne (Polizei, Feuerwehr, Ambulanz, Krankenhäuser) und nationale Führungsstrukturen (COBR/Gold-Kommandos) sind erprobt, aber Belastungen durch Personalengpässe, Transport- und Bettenverfügbarkeit sowie parallele Krisen (z. B. pandemische oder klimabedingte Ereignisse) können die Reaktionsfähigkeit in großflächigen Mehrfachvorfällen einschränken.
Evakuierungs-, Kommunikations- und Wiederherstellungspläne existieren; ihre Wirksamkeit hängt jedoch stark von interdisziplinärer Übung, Ressourcenallokation und schnellem Informationsaustausch ab.
Jihadistische Aktivitäten im Maghreb und Westafrika
Im Juli 2025 wurde in Westafrika ein Rückgang der registrierten jihadistischen Anschläge verzeichnet, mit insgesamt 101 Angriffen, die etwa 570 Todesopfer forderten – vor allem Zivilisten, Sicherheitskräfte und Mitglieder lokaler Milizen. Dieser Rückgang sollte jedoch nicht als Nachlassen der Bedrohung interpretiert werden, sondern als strategische und taktische Umorientierung der Gruppen in der Region.
Die Gruppe “Jamaat Nusrat al-Islam wal-Muslimin” (JNIM) bleibt der dominierende Akteur und ist für über 60 % der Angriffe verantwortlich, insbesondere in Burkina Faso, Mali, Niger und Togo. Die Angriffe umfassen Hinterhalte, Sprengfallen (IEDs), Schusswechsel und gezielte Tötungen, mit einem hohen Anteil ziviler Opfer. Parallel intensiviert der “Islamische Staat in Westafrika” (IS-WA) zusammen mit seiner nigerianischen Niederlassung seine Aktivitäten in Niger, Nigeria, Tschad und Kamerun, wobei der Schwerpunkt auf Angriffen gegen Zivilisten liegt.
Im Maghreb war die jihadistische Aktivität im Juli begrenzt, jedoch gab es vereinzelte Vorfälle in Algerien und Libyen. In Algerien übergaben zwei Mitglieder von AQMI sich freiwillig an das Militär, während in Libyen drei IS-nahe Zellen im Süden des Landes durch Geheimdienste neutralisiert wurden. Diese Zellen waren in Rekrutierung, Menschenhandel und Geldwäsche aktiv, was auf eine fortbestehende Präsenz jihadistischer Netzwerke hinweist.
Ein wichtiger politischer Schritt war die Konsolidierung der Sahel-Staaten-Allianz (AES) durch einen Vertrag, der eine Verteidigungs- und Unterstützungsgemeinschaft begründet. Dies könnte Spannungen mit der Wirtschaftsgemeinschaft westafrikanischer Staaten (ECOWAS) erzeugen und Länder wie Ghana oder die Elfenbeinküste isolieren, wodurch Instabilität begünstigt wird.
JNIM verlagert seine Aktivitäten zudem strategisch nach Süden und Westen in Mali und Burkina Faso, mit koordinierten Hinterhalten nahe der Grenze zu Senegal und zunehmender territorialer Kontrolle. Dies erhöht das Risiko einer Ausbreitung von Gewalt auf Mauritanien, Guinea und Senegal.
Die anhaltende Bedrohung durch Boko Haram in West- und Zentralafrika
Trotz intensiver militärischer Einsätze auf lokaler, regionaler und internationaler Ebene gelingt es bislang nicht, die Terrorgruppe Boko Haram endgültig zu neutralisieren. Die Organisation entstand 2009 im nigerianischen Bundesstaat Borno, hat aber ihr Einflussgebiet deutlich auf Nachbarstaaten wie Niger, Tschad und Kamerun ausgeweitet. Dabei wird die Gewalt durch interne Fraktionskämpfe nicht geschwächt: Die Gruppe ist in eine al-Qaida-nahe und eine IS-gestützte Fraktion zerfallen, die sich gegenseitig Konkurrenz machen, jedoch weiterhin systematisch Anschläge verüben.
Im August 2025 zeigte sich ein besorgniserregender Trend: Obwohl die Gesamtzahl der Angriffe leicht zurückging, stieg die Zahl der Todesopfer erheblich auf 338. Entführungen werden weiterhin routinemäßig als Mittel zur Finanzierung, zur Erpressung und zur Machtdemonstration eingesetzt, was die humanitäre Lage in der Region zusätzlich verschärft.
Die Gründe für das Fortbestehen von Boko Haram sind vielschichtig. Politische Instabilität und Korruption in Nigeria schwächen staatliche Kontrollmechanismen. Gleichzeitig verschärfen ethnische und religiöse Spannungen die Verwundbarkeit der Gesellschaften. Die multilaterale Bekämpfung durch die „Multinationale Joint Task Force“ bleibt fragmentiert: Finanzielle Engpässe, logistische Schwierigkeiten und politische Interessenskonflikte der beteiligten Staaten verhindern eine konsequente, koordinierte Strategie. Grenzüberschreitende kriminelle Netzwerke und die Einmischung internationaler Akteure erschweren darüber hinaus die Bekämpfung der Gruppe.
Die andauernde Gewalt hat massive Auswirkungen auf die betroffenen Bevölkerungen. Unsichere Lebensverhältnisse, zerstörte Infrastruktur und die ständige Bedrohung durch Entführungen oder Anschläge erschweren Entwicklung und Stabilität erheblich. Ohne umfassende Reformen, stärkere regionale Zusammenarbeit und die Einbindung der lokalen Bevölkerung bleibt die Region ein dauerhaftes Sicherheitsrisiko.
Zusammenfassend zeigt die Lage, dass militärische Mittel allein nicht ausreichen. Nur durch eine Kombination aus politischer Stabilisierung, Korruptionsbekämpfung, sozialer Integration und verbesserter grenzüberschreitender Kooperation kann die langfristige Bedrohung durch Boko Haram wirksam eingedämmt werden.
