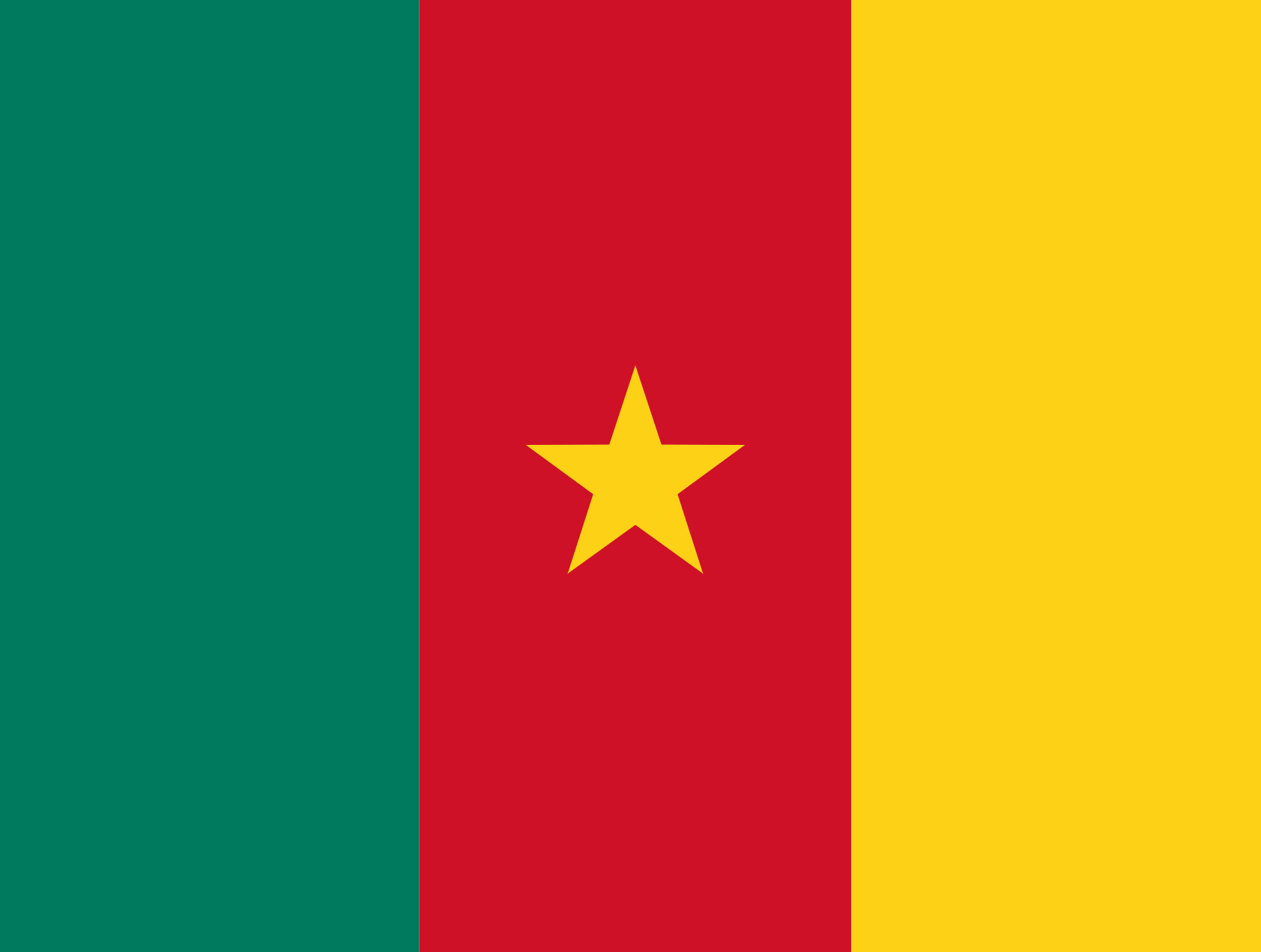
Kamerun
Kamerun sieht sich aktuell zwei räumlich und ursächlich unterschiedlichen, aber miteinander verflochtenen Bedrohungen gegenüber.
Im Norden wirken Ableger und Fraktionen von Boko Haram / ISWAP weiterhin aktiv; ihre Angriffe, Entführungen und der Einsatz von IEDs (Sprengfallen) haben sich in den vergangenen Jahren wiederholt und stellen für Zivilbevölkerung und Sicherheitskräfte ein hohes Risiko dar.
Gleichzeitig hält der seit 2016 andauernde „Anglophone“-Konflikt im Nordwesten und Südwesten (Ambazonien-Separatisten) an: Angriffe auf Sicherheitskräfte, Anschläge auf Infrastruktur, Entführungen und willkürliche Gewalt gegen Zivilisten prägen die Lage und haben zu tausenden Toten und Hunderttausenden Binnenvertriebenen geführt.
Regional operierende kriminelle Netzwerke (z. B. Entführungsbanden entlang der Grenze zu Nigeria/Chad) und die geografische Nähe zu instabilen Nachbarstaaten begünstigen grenzüberschreitende Mobilität von Kämpfern, Waffen und Schmugglern; dies erschwert effektive Grenzsicherung und fördert eine Vermischung von Terrorismus, Aufstandsgewalt und organisiertem Verbrechen.
Im Far-North sind die Hauptziele: ländliche Dörfer, Märkte, Schulen, humanitäre Einrichtungen, Militär- und Polizeiposten sowie Verkehrswege (insbesondere Landstraßen und Grenzposten). Häufige Anschlagsarten sind Überfälle, Brandstiftung, Entführungen (auch von Lehrkräften oder religiösen Autoritäten), Hinterhalte mit Kleinwaffen und das Legen von IEDs gegen Militär- oder Fahrzeugkonvois. Die Täter nutzen die dünn überwachten Grenzräume, Inseln und Sümpfe des Tschadseebeckens zur Flucht und Vernetzung.
In den anglophonen Regionen sind Anschläge differenzierter: gezielte Angriffe auf Regierungs- oder Sicherheitsziele, Straßensprengfallen, Geiselnahmen (auch von internationalen Mitarbeitern und Geistlichen) sowie Sabotage gegen Infrastruktur (Strom, Kommunikation) sind zu beobachten. In städtischen Zentren (Douala, Yaoundé, Bamenda) bleibt das Risiko für Anschläge geringer als in den Konfliktzonen, aber symbolische Angriffe (z. B. auf Behördengebäude, Versammlungsorte) oder Entführungen sind nicht ausgeschlossen — zudem besteht in urbanen Räumen ein höheres Risiko für radikalisierten Einzeltäter oder Kleingruppenaktionen. Ländliche Gebiete sind besonders verwundbar wegen begrenzter Polizeipräsenz und schlechter Infrastruktur.
Konkrete, öffentlich zugängliche Zahlen zu kamerunischen Rückkehrern aus Syrien/Irak oder anderen Konfliktgebieten sind begrenzt; generell besteht aber das Risiko, dass rückkehrende Kämpfer oder inländisch radicalisierte Personen gewaltbereite Netzwerke verstärken.
Regionale Dynamiken (Einfluss von IS/ISIS-Fraktionen, Propaganda, lokale Grievances wie Marginalisierung, Arbeitslosigkeit) schaffen Rekrutierungsbedingungen, vor allem in isolierten, wirtschaftlich marginalisierten Gemeinden. Programme zur Überwachung und Reintegration sind in der Region insgesamt heterogen und oft schlecht finanziert, was das Rückkehrer-Risiko erhöht.
Kamerun verfügt über ein weit verzweigtes Sicherheitsapparat-Repertoire (Reguläre Armee, Rapid Intervention Battalions, Gendarmerie, Polizeikräfte und lokale Milizen/vigilante-Gruppen), setzt Militäraktionen in besonders betroffenen Regionen ein und nutzt gesetzliche Instrumente zur Terrorismusbekämpfung (Anti-Terrorgesetze, Ausnahmezustände in bestimmten Provinzen). Internationale Kooperationsformen — insbesondere multilaterale Einsätze im Lake-Chad-Becken (Multinational Joint Task Force, MNJTF) sowie bilaterale Zusammenarbeit mit Frankreich, den USA und regionalen Partnern — ergänzen nationale Kapazitäten, sind aber von Koordinationsproblemen, politischer Volatilität der Nachbarstaaten und Ausstiegen einzelner Partner betroffen, was die Wirksamkeit zeitweise schmälert.
Praktisch führt dies zu einer Sicherheitslage, in der punktuelle militärische Erfolge möglich sind, langfristige Stabilisierung jedoch ohne stärkere zivile Governance, wirtschaftliche Entwicklung und Versöhnungsprozesse schwer zu erreichen ist. Menschenrechtsbedenken (Berichte über exzessive Gewalt durch Sicherheitskräfte) beeinträchtigen zudem Vertrauensbildung in betroffenen Gemeinden.
Die medizinische und humanitäre Infrastruktur ist in stark betroffenen Gebieten (Far-North, Nordwest/Südwest) stark belastet: Krankenhäuser, Evakuierungskapazitäten und Notfalltransport sind begrenzt; humanitäre Hilfspläne (z. B. IOM/UN/NGO-Crisis-Response-Pläne) adressieren zwar Binnenvertriebene und medizinische Soforthilfe, doch Logistik, Personal und nachhaltige Wiederaufbau-Finanzierung bleiben Engpässe.
Evakuierungs- und Krisenmanagementpläne existieren auf nationaler und internationaler Ebene, sind jedoch in der Praxis abhängig von Zugangssicherheit, Kommunikationsinfrastruktur und der Fähigkeit, Konfliktparteien sichere Korridore zu gewährleisten.
Die Gesundheitssektorkapazität wird zunehmend durch Initiativen der WHO/AFRO und Partner bewertet und schrittweise gestärkt (Notfall- und Intensivpflege, Train-the-Trainer-Programme), doch das Niveau bleibt regional ungleich verteilt.
Jihadistische Aktivitäten im Maghreb und Westafrika
Im Juli 2025 wurde in Westafrika ein Rückgang der registrierten jihadistischen Anschläge verzeichnet, mit insgesamt 101 Angriffen, die etwa 570 Todesopfer forderten – vor allem Zivilisten, Sicherheitskräfte und Mitglieder lokaler Milizen. Dieser Rückgang sollte jedoch nicht als Nachlassen der Bedrohung interpretiert werden, sondern als strategische und taktische Umorientierung der Gruppen in der Region.
Die Gruppe “Jamaat Nusrat al-Islam wal-Muslimin” (JNIM) bleibt der dominierende Akteur und ist für über 60 % der Angriffe verantwortlich, insbesondere in Burkina Faso, Mali, Niger und Togo. Die Angriffe umfassen Hinterhalte, Sprengfallen (IEDs), Schusswechsel und gezielte Tötungen, mit einem hohen Anteil ziviler Opfer. Parallel intensiviert der “Islamische Staat in Westafrika” (IS-WA) zusammen mit seiner nigerianischen Niederlassung seine Aktivitäten in Niger, Nigeria, Tschad und Kamerun, wobei der Schwerpunkt auf Angriffen gegen Zivilisten liegt.
Im Maghreb war die jihadistische Aktivität im Juli begrenzt, jedoch gab es vereinzelte Vorfälle in Algerien und Libyen. In Algerien übergaben zwei Mitglieder von AQMI sich freiwillig an das Militär, während in Libyen drei IS-nahe Zellen im Süden des Landes durch Geheimdienste neutralisiert wurden. Diese Zellen waren in Rekrutierung, Menschenhandel und Geldwäsche aktiv, was auf eine fortbestehende Präsenz jihadistischer Netzwerke hinweist.
Ein wichtiger politischer Schritt war die Konsolidierung der Sahel-Staaten-Allianz (AES) durch einen Vertrag, der eine Verteidigungs- und Unterstützungsgemeinschaft begründet. Dies könnte Spannungen mit der Wirtschaftsgemeinschaft westafrikanischer Staaten (ECOWAS) erzeugen und Länder wie Ghana oder die Elfenbeinküste isolieren, wodurch Instabilität begünstigt wird.
JNIM verlagert seine Aktivitäten zudem strategisch nach Süden und Westen in Mali und Burkina Faso, mit koordinierten Hinterhalten nahe der Grenze zu Senegal und zunehmender territorialer Kontrolle. Dies erhöht das Risiko einer Ausbreitung von Gewalt auf Mauritanien, Guinea und Senegal.
Die anhaltende Bedrohung durch Boko Haram in West- und Zentralafrika
Trotz intensiver militärischer Einsätze auf lokaler, regionaler und internationaler Ebene gelingt es bislang nicht, die Terrorgruppe Boko Haram endgültig zu neutralisieren. Die Organisation entstand 2009 im nigerianischen Bundesstaat Borno, hat aber ihr Einflussgebiet deutlich auf Nachbarstaaten wie Niger, Tschad und Kamerun ausgeweitet. Dabei wird die Gewalt durch interne Fraktionskämpfe nicht geschwächt: Die Gruppe ist in eine al-Qaida-nahe und eine IS-gestützte Fraktion zerfallen, die sich gegenseitig Konkurrenz machen, jedoch weiterhin systematisch Anschläge verüben.
Im August 2025 zeigte sich ein besorgniserregender Trend: Obwohl die Gesamtzahl der Angriffe leicht zurückging, stieg die Zahl der Todesopfer erheblich auf 338. Entführungen werden weiterhin routinemäßig als Mittel zur Finanzierung, zur Erpressung und zur Machtdemonstration eingesetzt, was die humanitäre Lage in der Region zusätzlich verschärft.
Die Gründe für das Fortbestehen von Boko Haram sind vielschichtig. Politische Instabilität und Korruption in Nigeria schwächen staatliche Kontrollmechanismen. Gleichzeitig verschärfen ethnische und religiöse Spannungen die Verwundbarkeit der Gesellschaften. Die multilaterale Bekämpfung durch die „Multinationale Joint Task Force“ bleibt fragmentiert: Finanzielle Engpässe, logistische Schwierigkeiten und politische Interessenskonflikte der beteiligten Staaten verhindern eine konsequente, koordinierte Strategie. Grenzüberschreitende kriminelle Netzwerke und die Einmischung internationaler Akteure erschweren darüber hinaus die Bekämpfung der Gruppe.
Die andauernde Gewalt hat massive Auswirkungen auf die betroffenen Bevölkerungen. Unsichere Lebensverhältnisse, zerstörte Infrastruktur und die ständige Bedrohung durch Entführungen oder Anschläge erschweren Entwicklung und Stabilität erheblich. Ohne umfassende Reformen, stärkere regionale Zusammenarbeit und die Einbindung der lokalen Bevölkerung bleibt die Region ein dauerhaftes Sicherheitsrisiko.
Zusammenfassend zeigt die Lage, dass militärische Mittel allein nicht ausreichen. Nur durch eine Kombination aus politischer Stabilisierung, Korruptionsbekämpfung, sozialer Integration und verbesserter grenzüberschreitender Kooperation kann die langfristige Bedrohung durch Boko Haram wirksam eingedämmt werden.
