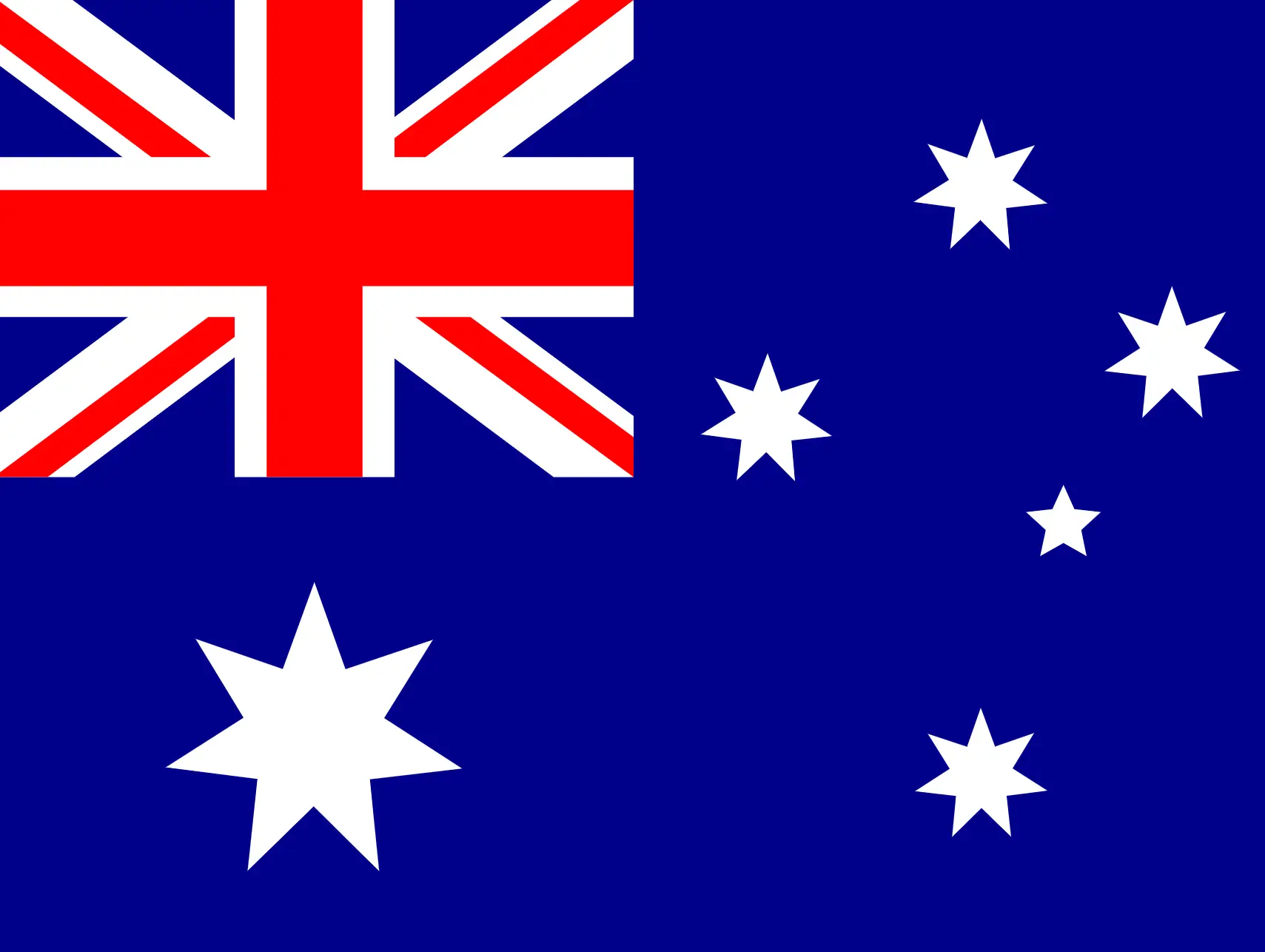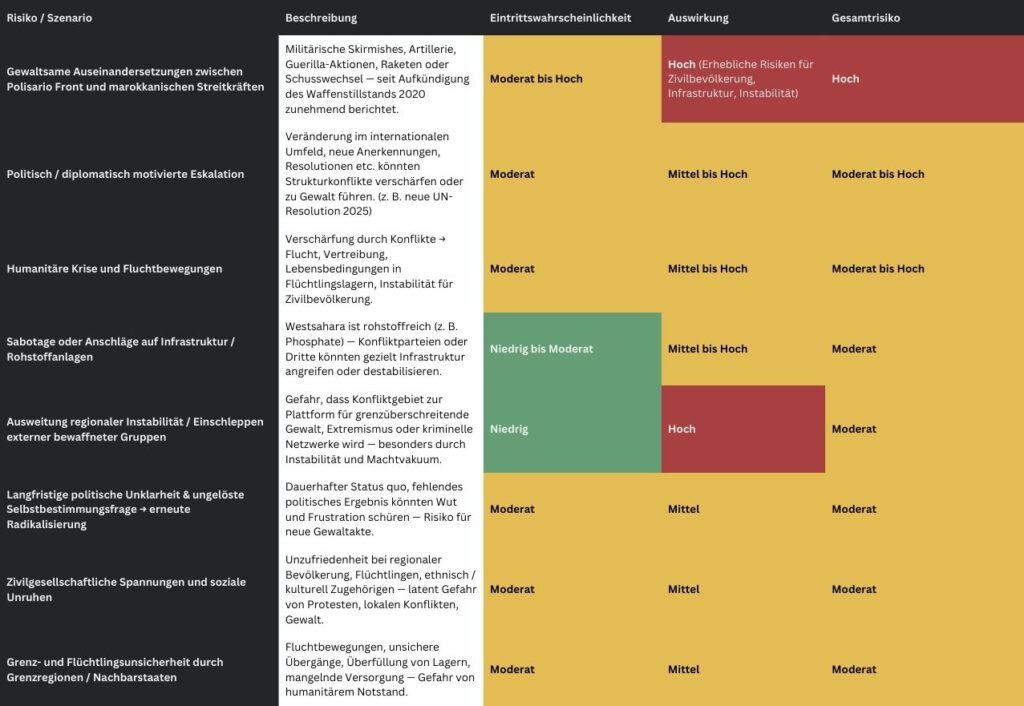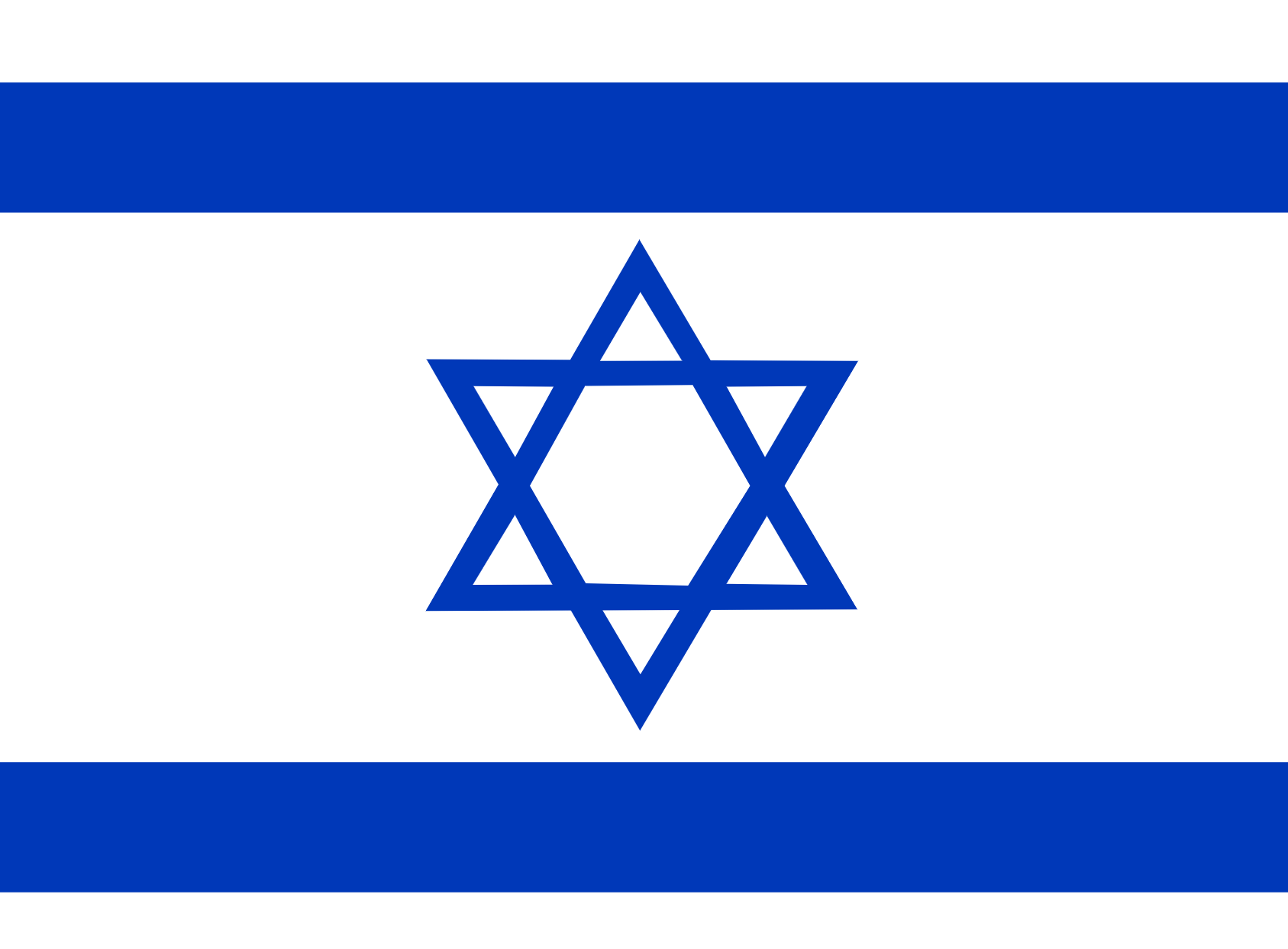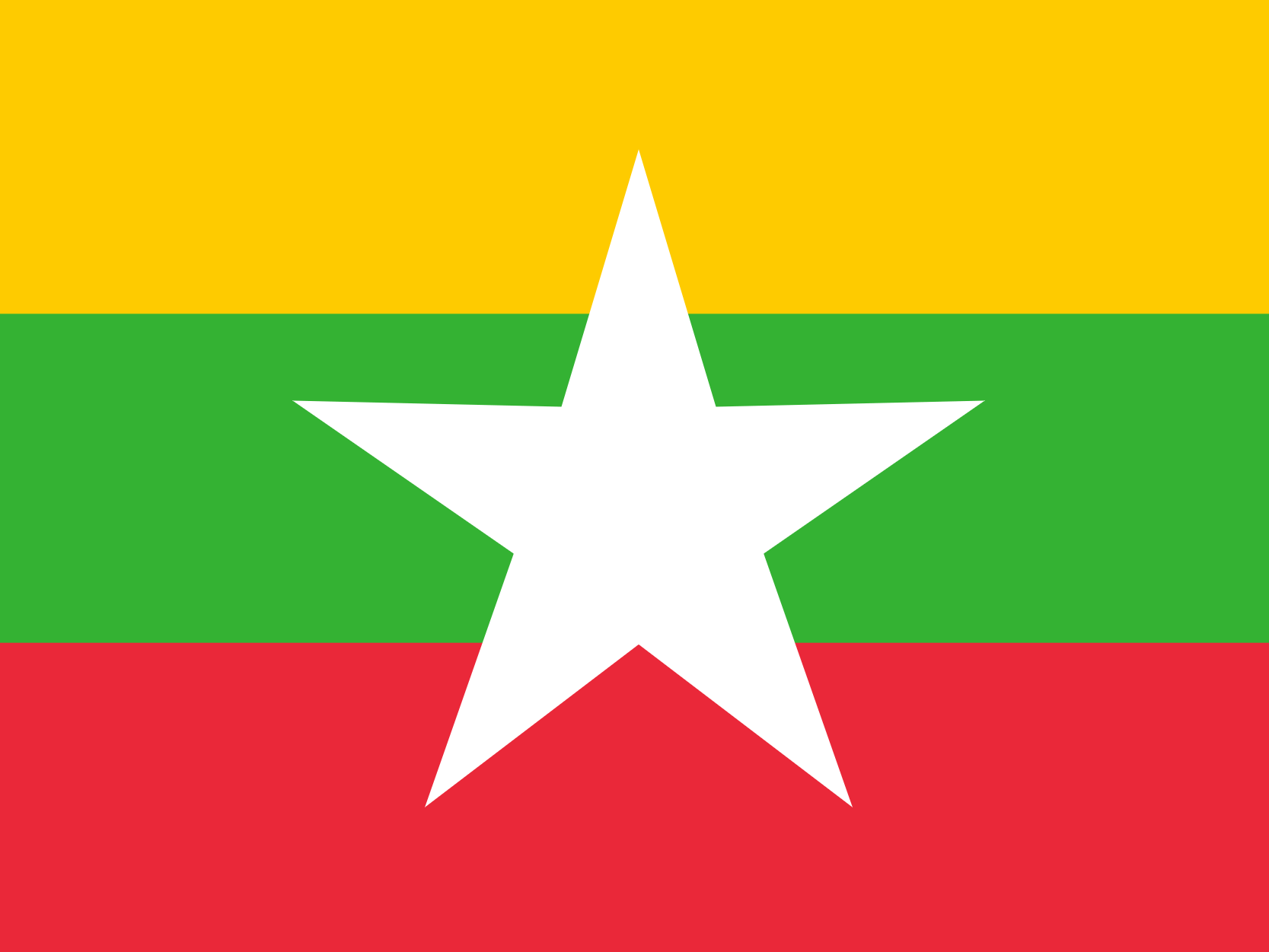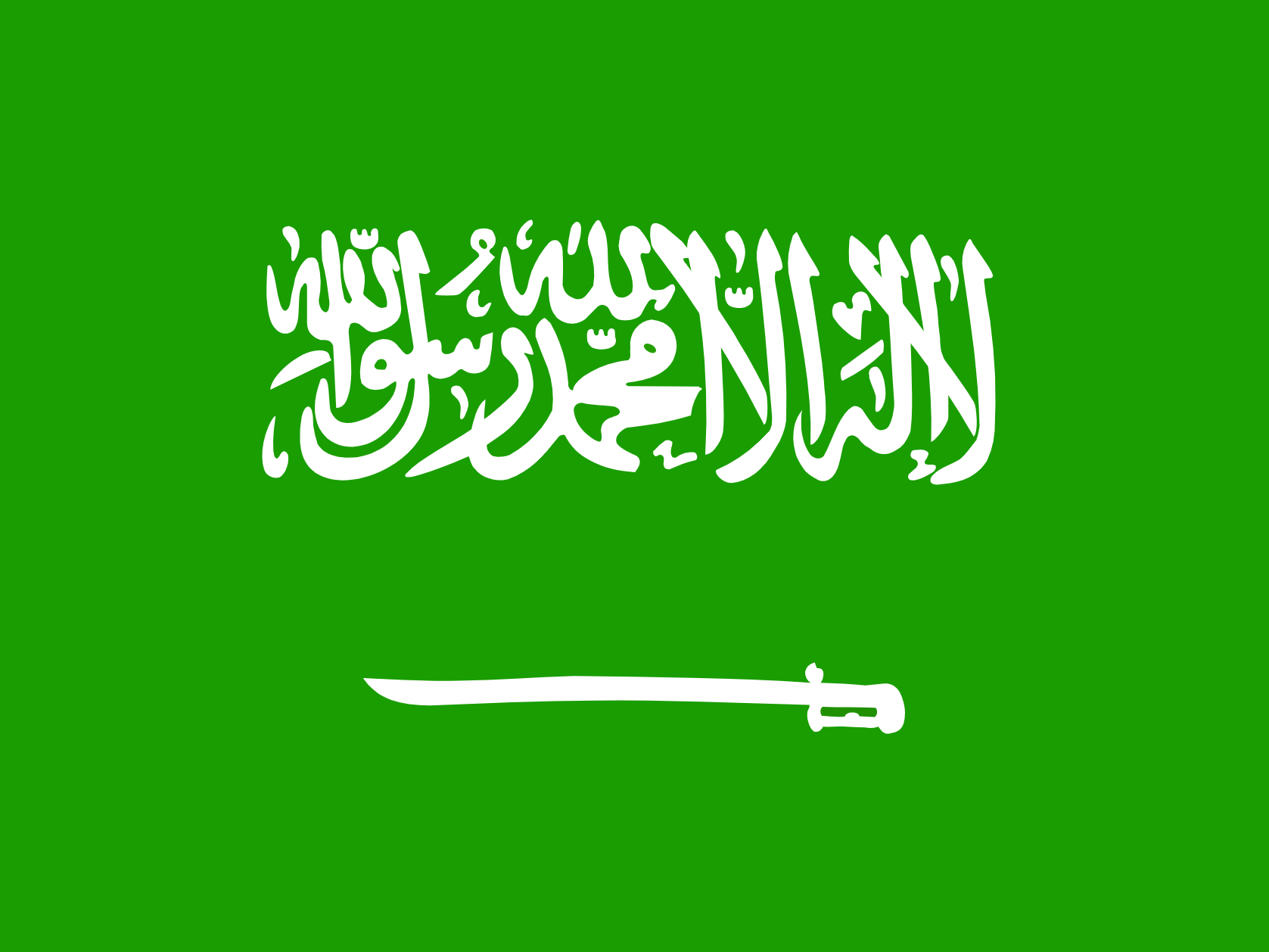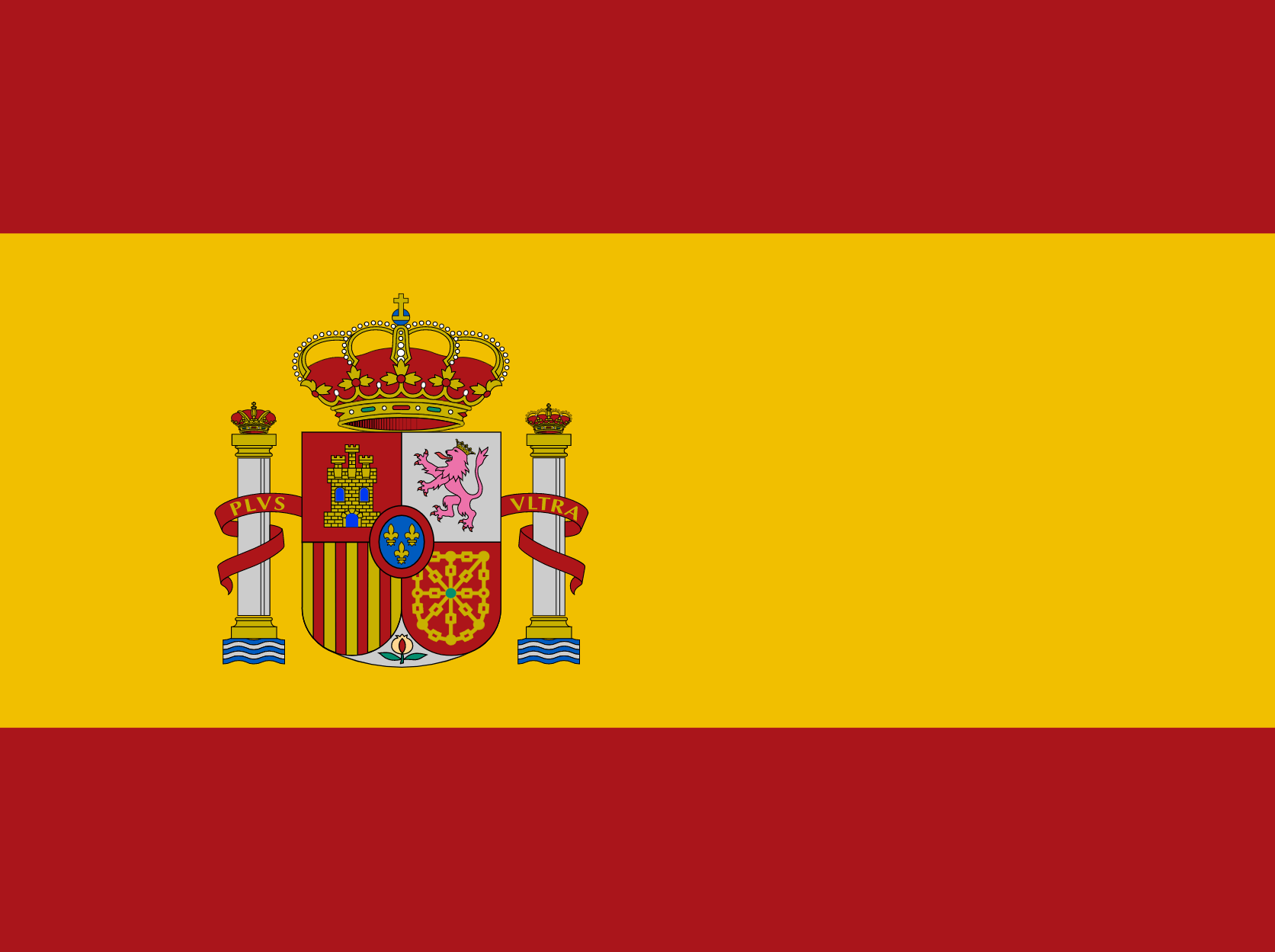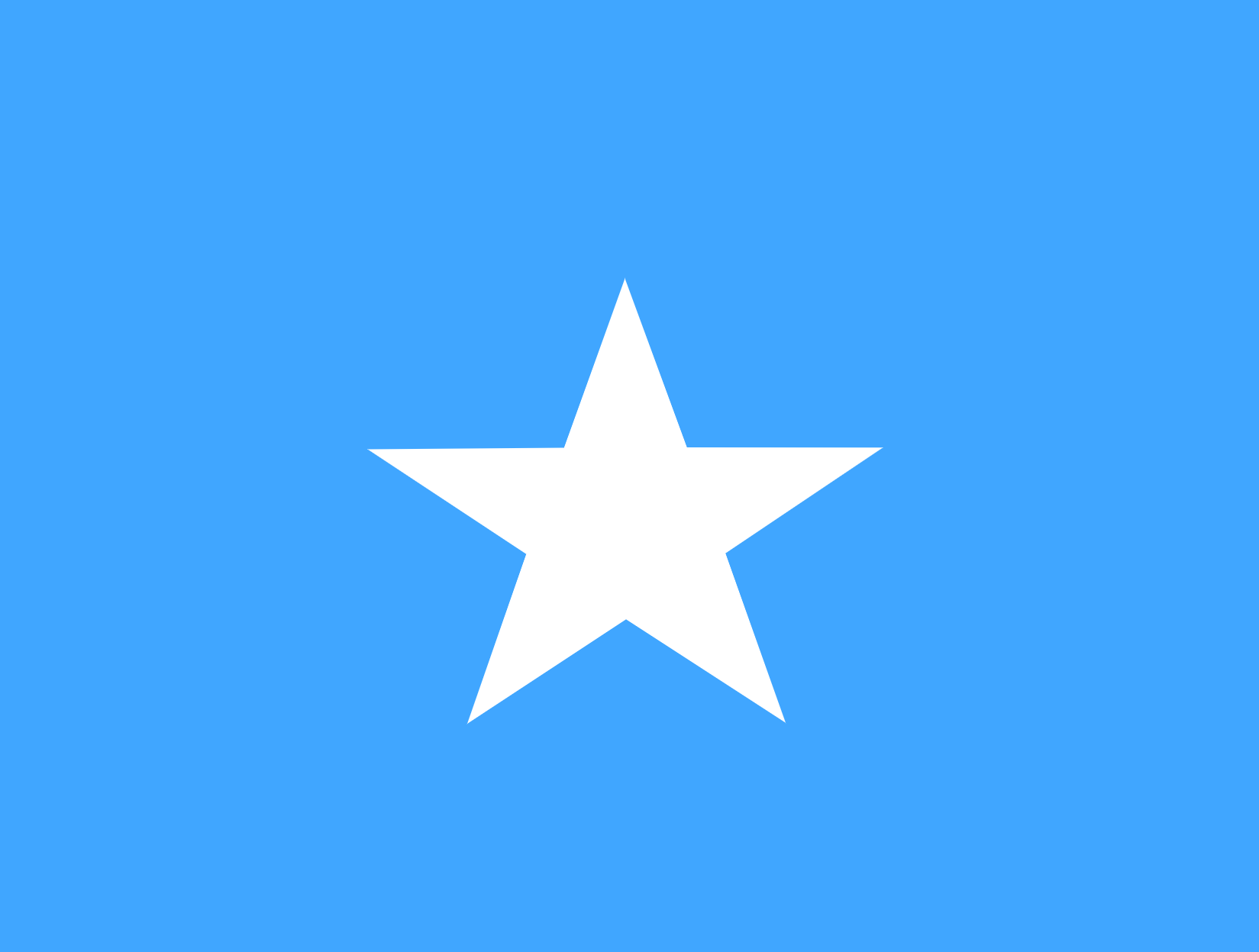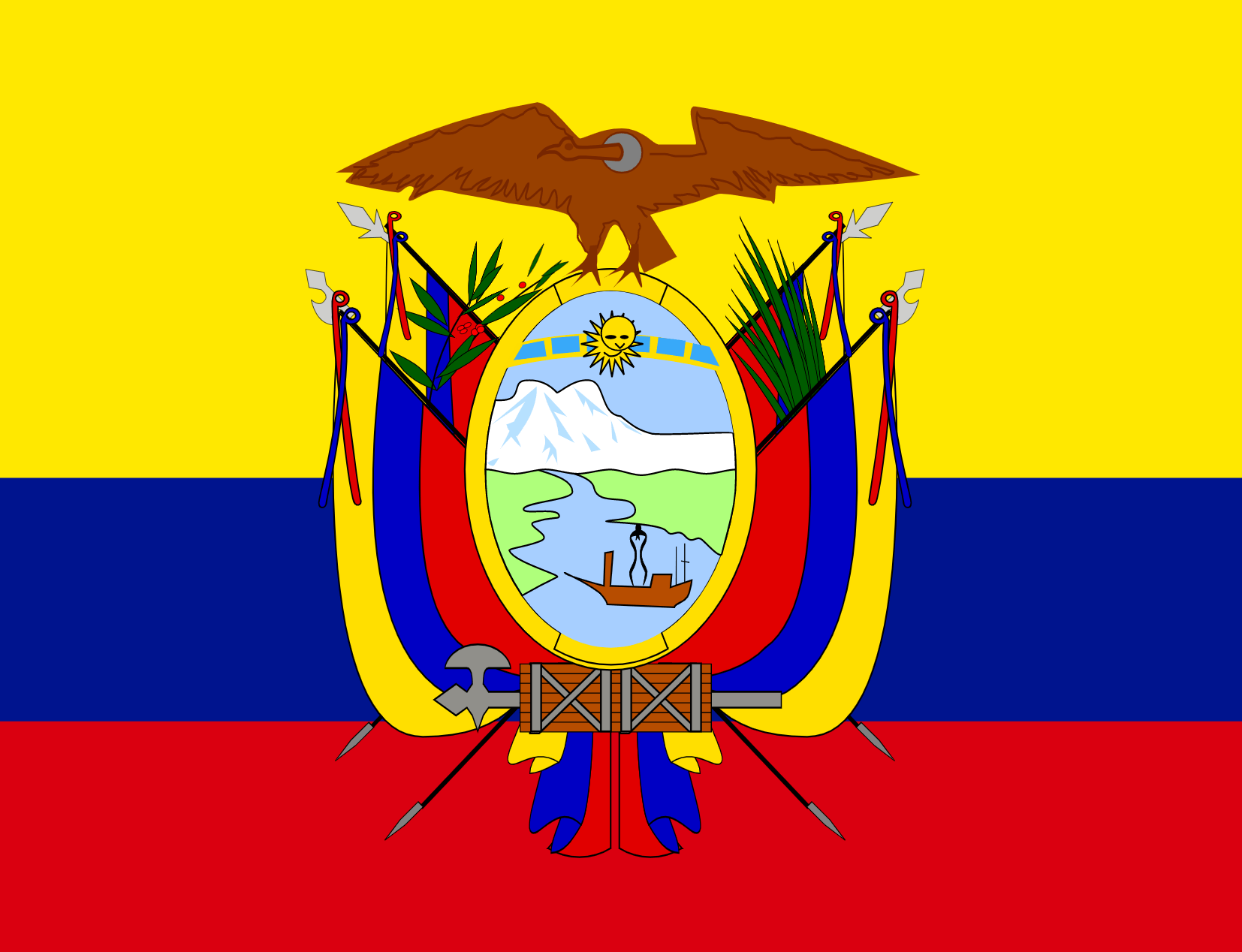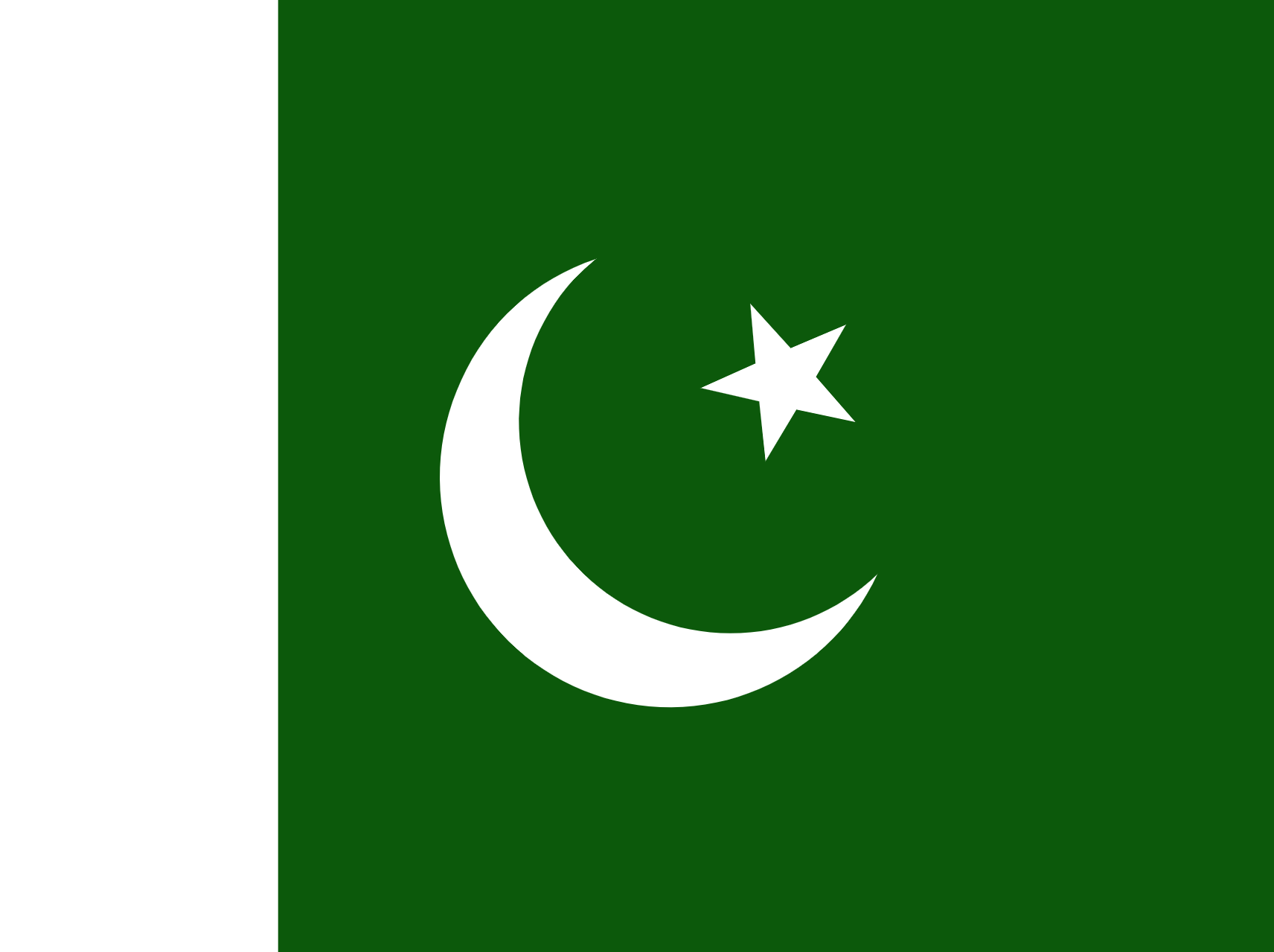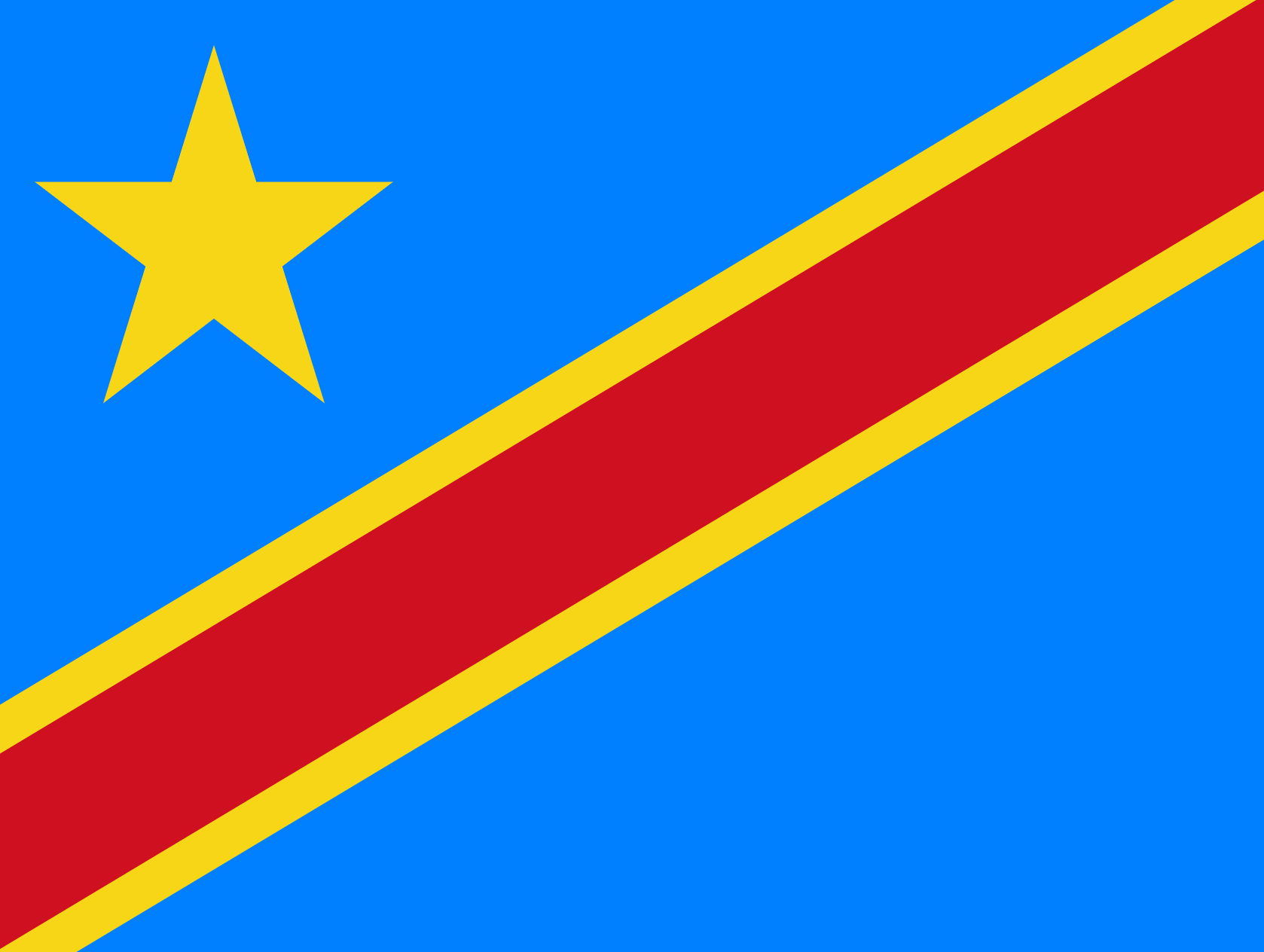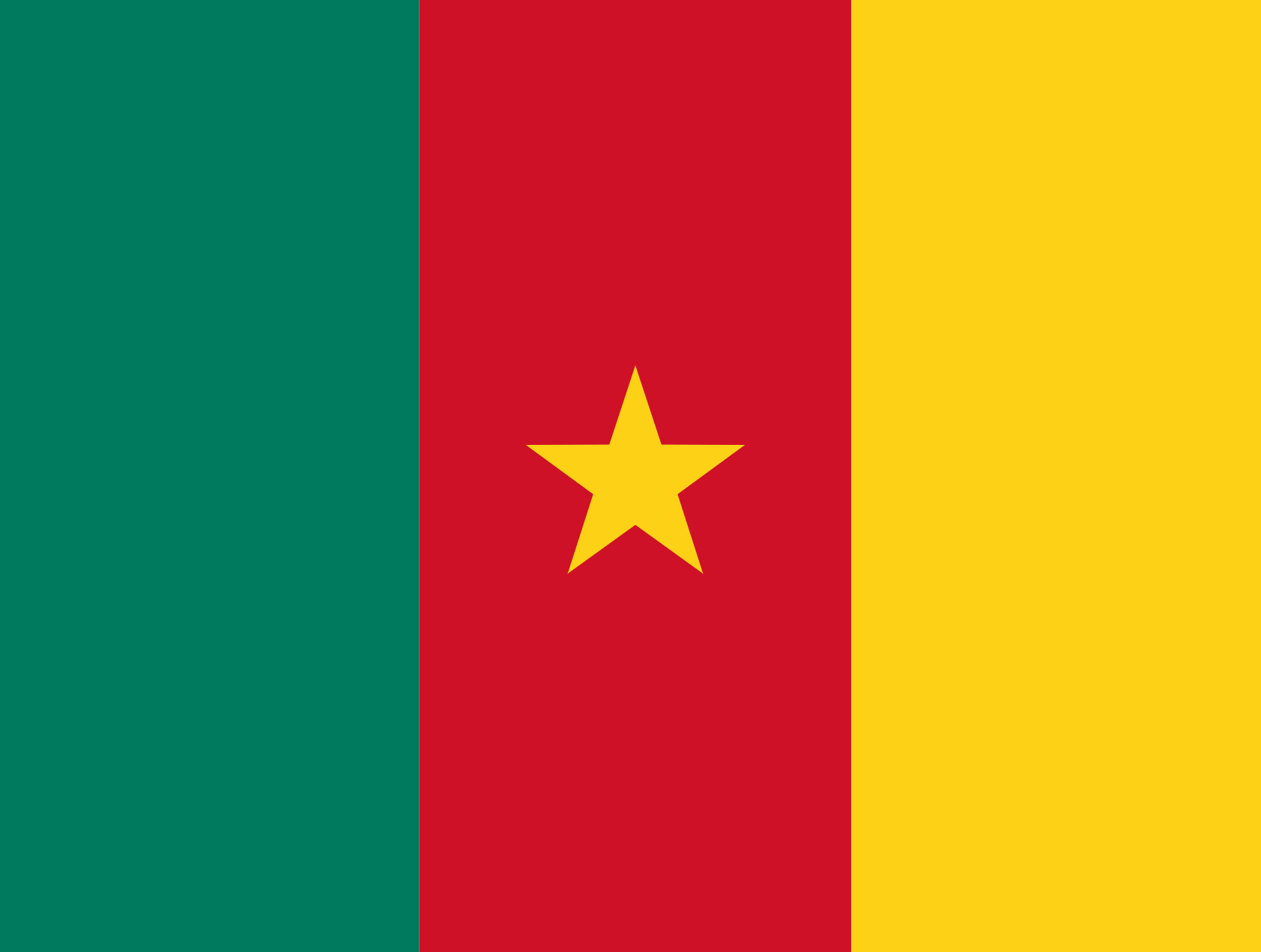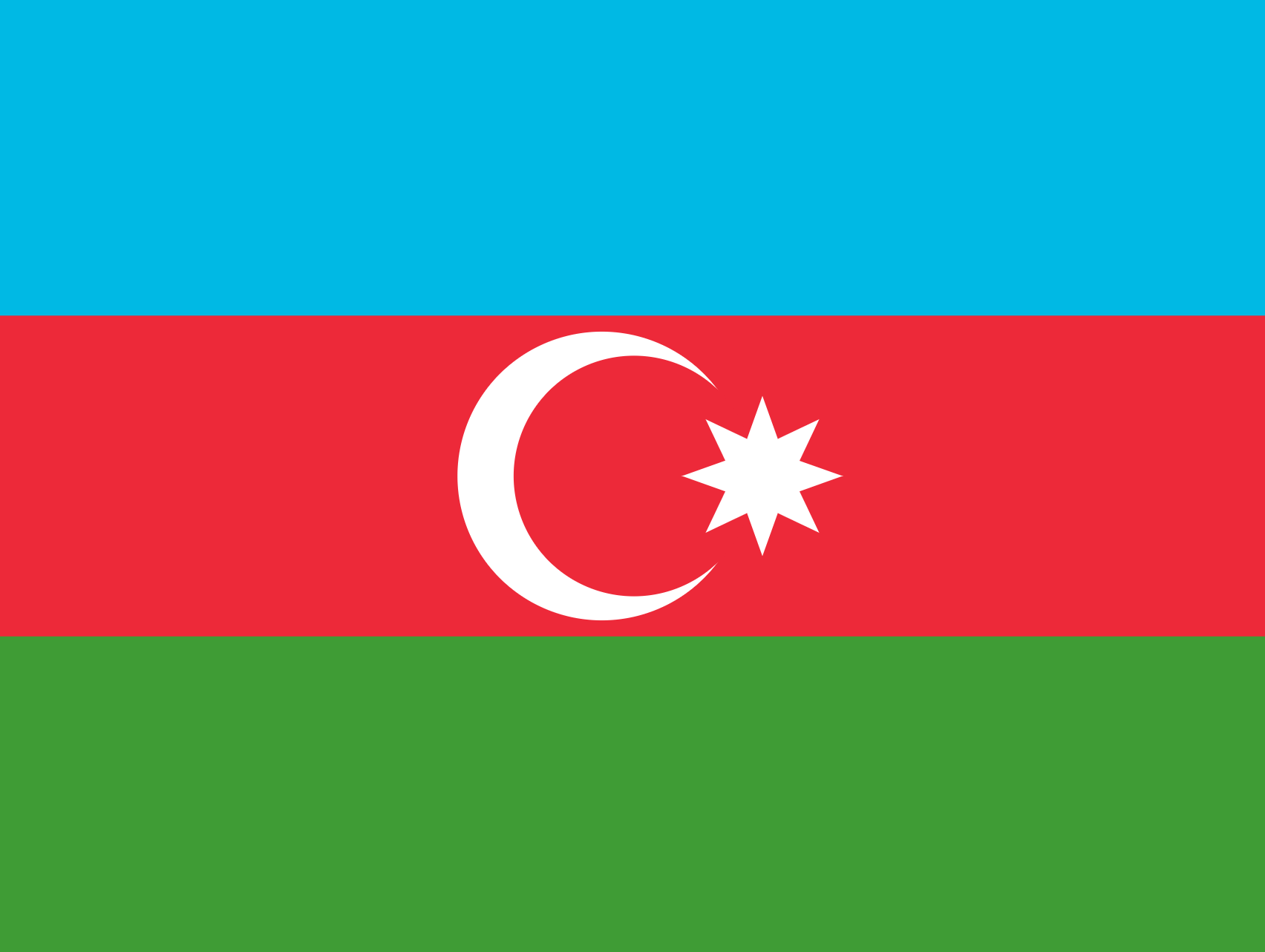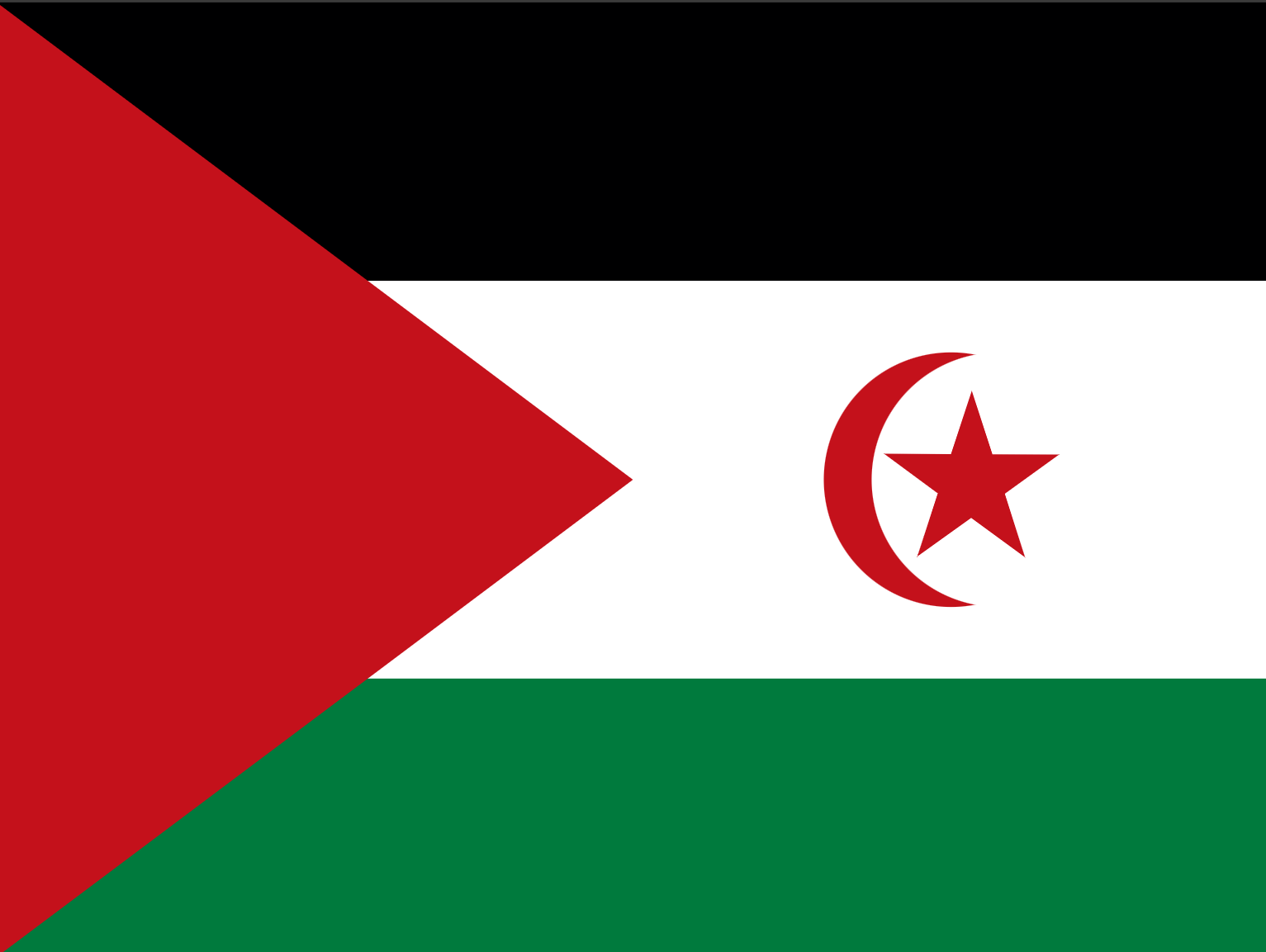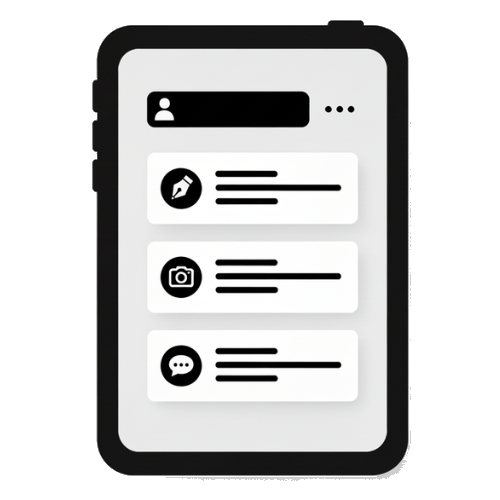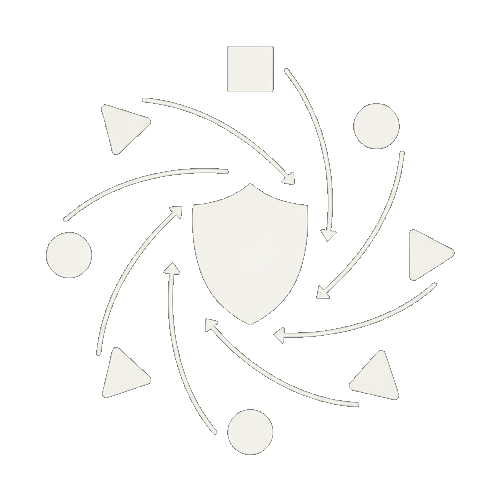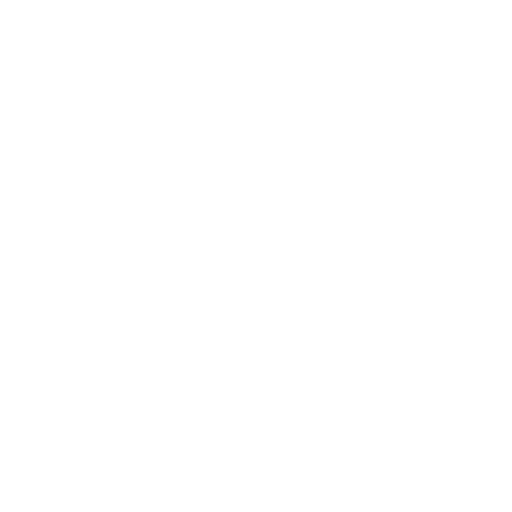Anschlagsarten
Anschlagsziel
Gruppierungen
Terrorismusbekämpfung
Sortieren
Filter löschen
IM FOKUS
TERRORISMUSBEKÄMPFUNG
Die Maßnahmen zur Terrorismusbekämpfung in der Westsahara werden maßgeblich durch Marokko bestimmt, das seine umfassende Anti-Terror-Gesetzgebung und Sicherheitsstrategie auf die umstrittene Region anwendet. Marokko hat nach den Anschlägen von Casablanca 2003 ein weitreichendes Gesetzespaket (u. a. Gesetz 03-03) verabschiedet, das Definition, Verfolgung und Strafrahmen für terroristische Aktivitäten deutlich ausweitet, die Polizei- und Geheimdienstbefugnisse erweitert und die Bekämpfung von Rekrutierung, Propaganda und Finanzierung einschließt. In den von Rabat kontrollierten Teilen der Westsahara bedeutet dies eine ausgeprägte Präsenz von Sicherheitskräften (Polizei, Gendarmerie, Militär und Nachrichtendienste), Kontrollpunkten sowie Überwachungsmaßnahmen, die offiziell mit der Abwehr terroristischer und separatistischer Bedrohungen begründet werden, in Menschenrechtsberichten aber auch mit Repression und Übergriffen in Verbindung gebracht werden.
Grenzsicherungsmaßnahmen umfassen umfangreiche militärische Sperranlagen, Minenfelder und Überwachungsstrukturen entlang des sogenannten „Berms“, der de facto die von Marokko kontrollierten Gebiete von den von der Polisario beanspruchten Zonen trennt, sowie verstärkte Kontrollen an Übergängen zu Algerien und Mauretanien. Marokko nimmt darüber hinaus eine aktive Rolle in regionalen und internationalen Anti-Terror-Foren ein, arbeitet eng mit europäischen und US-amerikanischen Stellen zusammen, beteiligt sich an Informationsaustausch, Ausbildungen und gemeinsamen Initiativen zur Bekämpfung von Terrorismus und gewaltbereitem Extremismus und bezieht in seine Strategie ausdrücklich auch den sahelo-saharischen Raum ein, zu dem de facto auch die Westsahara gehört. Für die Polisario-kontrollierten Flüchtlingslager in Tindouf (Algerien) ist die Sicherheitsverantwortung im Kern Algerien zugeordnet; hier werden von internationalen Beobachtern regelmäßig Risiken einer möglichen Infiltration durch jihadistische Gruppen oder kriminelle Netzwerke angesprochen, ohne dass systematische terroristische Anschlagserien dokumentiert wären.
Die Notfallvorsorge in der Westsahara ist stark von den eingeschränkten zivilen Kapazitäten, der dünnen Besiedlung und der politischen Sonderlage geprägt. In den marokkanisch kontrollierten Städten existiert eine grundlegende medizinische und rettungsdienstliche Infrastruktur, die bei Anschlägen oder gewaltsamen Auseinandersetzungen Erstversorgung und begrenzte stationäre Behandlung übernehmen kann, bei schweren Lagen aber auf Evakuierungen in größere marokkanische Zentren angewiesen wäre. In ländlichen und Wüstengebieten bleibt die medizinische Erreichbarkeit deutlich eingeschränkt, so dass selbst kleinere Angriffe, Minenunfälle oder Überfälle aufgrund langer Transportwege und begrenzter Rettungsmittel ein überproportional hohes Opfer- und Komplikationsrisiko bergen. Formale Krisenmanagementstrukturen sind eng mit marokkanischen Behörden verbunden und orientieren sich an Rabats nationalem Sicherheits- und Katastrophenmanagement; in den von der Polisario verwalteten Camps greifen hingegen vor allem internationale und algerische Strukturen sowie Mechanismen von UN-Organisationen und NGOs, die bei sicherheitsrelevanten Vorfällen und humanitären Krisen koordiniert reagieren.
ANALYSE & KONTEXT
Taliban-Aufstand verschärft Sicherheitslage und Spannungen
Die jüngste Analyse zum stärksten Taliban-Aufstand Pakistans seit einem Jahrzehnt verdeutlicht eine eskalierende Sicherheitskrise in der Region. Nachdem Pakistan in den 2010er Jahren mit US-Unterstützung die Taliban weitgehend unter Kontrolle gebracht hatte, erlebt das Land nun eine Renaissance des Aufstands, die vor allem durch den
Einfluss und die Unterstützung der afghanischen Taliban aus Afghanistan angeheizt wird.
In den letzten Monaten haben die “Tehreek-e-Taliban” (TTP) eine intensive uerillakampagne gegen Sicherheitskräfte geführt, was zu hohen Verlusten in den Reihen des Militärs, massiven Vertreibungen der Zivilbevölkerung und wachsender Unzufriedenheit unter der Bevölkerung in den betroffenen Grenzgebieten führte. Pakistan reagiert mit Drohnenangriffen und gezielten Militäroperationen, doch die Lage bleibt angespannt. Die geografisch schwer zugänglichen westlichen Regionen Pakistans, angrenzend an Afghanistan, sind zudem ein Rückzugsgebiet für islamistische Kämpfer, darunter auch Gruppen des “Islamischen Staates” (IS), was die Sicherheitslage weiter verkompliziert.
Die Zusammenarbeit und Unterstützung der afghanischen Taliban für die TTP verschärft die bilateralen Spannungen zwischen Pakistan und Afghanistan erheblich. Trotz formaler Abkommen kommt es immer wieder zu Grenzkonflikten und Militärschlägen – etwa Luftangriffen Pakistans auf mutmaßliche TTP-Stützpunkte in Afghanistan, welche von den afghanischen Taliban als Verletzung der Souveränität gewertet werden. Diese Militärschläge folgen auf eine Serie von Angriffen der TTP auf pakistanische Einrichtungen, bei denen zahlreiche Sicherheitskräfte getötet wurden.
Die jüngste Phase des Konflikts ist durch das Ende eines seit 2022 bestehenden Waffenstillstands gekennzeichnet, nach dem die TTP ihre Angriffe fortsetzte. Die pakistanische Armee startete daraufhin die Gegenoperationen unter dem Namen „Azm-e-Istkeham“ („Entschlossenheit zur Stabilität“), um gegen innere wie grenzüberschreitende Sicherheitsbedrohungen vorzugehen. Die UN berichtet von 6.000 bis 6.500 Kämpfern der TTP in Afghanistan und warnt vor einem möglichen Zusammenschluss mit anderen Terrorgruppen wie Al-Qaida, was die Gefahr für Pakistan und die Region weiter erhöhen würde.
Politisch betrachtet verdeutlicht der Konflikt eine tiefere strategische Fehlkalkulation Pakistans: Die Hoffnung, dass die Rückkehr der afghanischen Taliban zugunsten Pakistans ausfallen würde, hat sich als trügerisch erwiesen. Stattdessen verschärfen sich die Sicherheitsbedrohungen, die internen Konflikte und die bilateralen Spannungen zwischen Afghanistan und Pakistan weiter, mit potenziell destabilisierten Folgen für Südasien als Ganzes.
Diese Entwicklungen zeigen eindrücklich, dass ohne eine umfassende politische Lösung, welche die langjährigen politischen, ethnischen und sicherheitspolitischen Konflikte adressiert, Pakistan weiterhin mit einer der heftigsten Insurgency-Bedrohungen seit Jahren konfrontiert bleibt. Der anhaltende Aufstand gefährdet nicht nur die Stabilität Pakistans, sondern hat auch weitreichende Implikationen für die regionale Sicherheit im Kontext von Afghanistan, Indien und darüber hinaus.
TERRORISMUSBEDROHUNG
Die Westsahara weist als umstrittenes und teils militärisch kontrolliertes Gebiet keine ausgeprägte eigene terroristische Anschlagshistorie auf, ist jedoch in eine weitere sahel-saharaweite Konflikt- und Extremismusdynamik eingebettet, in der jihadistische Gruppen, organisierte Kriminalität und staatliche Gegenmaßnahmen der Nachbarländer – insbesondere Marokkos – ineinandergreifen. Das resultierende Terrorismusrisiko ist im Kern transnational: Es speist sich weniger aus klar identifizierten lokalen Terrorstrukturen als aus grenzüberschreitenden Netzwerken und Instabilität im weiteren Sahelraum, die auf entlegene Gebiete und Transitrouten rund um die Westsahara ausstrahlen können.
In der historischen Entwicklung wird der saharauische Befreiungsbewegung Polisario-Front von einigen Akteuren politisch oder propagandistisch mit „Terrorismus“-Vorwürfen belegt, während wichtige internationale Organisationen sie nicht als terroristische Organisation führen und die Bewegung selbst Gewalttaten mit terroristischer Zielsetzung zurückweist. Klassische jihadistische Gruppen wie “Al-Qaida im Islamischen Maghreb “(AQIM), der mit ihr verbundene Zusammenschluss “Jama’at Nusrat al-Islam wal-Muslimin” (JNIM) sowie der „Islamische Staat in der Größeren Sahara“ (IS-GS) operieren überwiegend in Mali, Niger und Burkina Faso, nutzen aber seit Jahren sahelo-saharische Wüstenräume, Schmuggelrouten und schwach kontrollierte Grenzgebiete, die in einem weiteren sicherheitsgeographischen Sinne auch das Umfeld der Westsahara betreffen. Direkte Terroranschläge in urbanen Zentren der Westsahara sind selten dokumentiert, doch die strukturelle Verwundbarkeit – dünne Besiedlung, lange Grenzen, politischer Grundkonflikt – wird in Analysen zum sahelo-saharischen Raum als möglicher Risikofaktor hervorgehoben.
Spezifische Risiken konzentrieren sich insbesondere auf folgende Dimensionen: Erstens gelten militärische Stellungen, Polizeiposten und Verwaltungsgebäude der marokkanischen Behörden in den von Rabat kontrollierten Landesteilen als potenzielle Ziele, da sie Symbol und Instrument der umstrittenen Herrschaftsausübung sind. Zweitens können Transport- und Lieferketten, inklusive Konvois, Grenzpassagen sowie logistische Knoten (etwa entlang der „Pufferzone“ und der Übergänge Richtung Mauretanien und Algerien), im Fokus kriminell-terroristischer Mischakteure stehen, bei denen Entführungen, Überfälle oder Sprengstoffanschläge eine Rolle spielen können. Drittens besteht ein allgemeines, wenn auch schwer quantifizierbares Risiko, dass grenzüberschreitende jihadistische Gruppen in schwach kontrollierten, ländlichen und wüstenhaften Gebieten Rückzugsräume, Lager oder Durchgangsrouten nutzen, ohne dass dies zwingend in offene Angriffe auf lokale Bevölkerung oder internationale Präsenz (z. B. UN-Personal in Nachbarregionen) münden muss.
Städtische Räume wie Laayoune oder Dakhla befinden sich unter starker marokkanischer Sicherheitspräsenz, was einerseits das Risiko unentdeckter Planung größerer Attacken reduziert, andererseits im Spannungsfall urbane Konfrontationen, Unruhen oder gezielte Anschläge gegen Sicherheitskräfte denkbar macht. In ländlichen und wüstenartigen Gebieten überwiegt dagegen die Gefahr indirekter Terrortypen – etwa Angriffe auf Patrouillen, Sprengfallen an Pisten, Überfälle auf Konvois oder punktuelle Entführungen – sowie die Nutzung dieser Räume für Rekrutierung, Waffen- und Drogentransit sowie terroristische Logistik im weiteren Sahelkonflikt. Für ausländische Zivilpersonen, NGOs oder Unternehmen ergibt sich ein besonderes Risiko weniger in den stark kontrollierten Stadtzentren, sondern eher bei Bewegungen in periphere Zonen und entlang grenznaher oder militärisch sensibler Abschnitte, wo die Trennung zwischen rein kriminellen und politisch-religiös motivierten Akteuren oftmals verschwimmt.
Zu Rückkehrern oder klar zuordenbaren lokal rekrutierten jihadistischen Zellen in der Westsahara selbst liegen kaum belastbare offene Informationen vor; die verfügbare Literatur betont vielmehr die Rolle des weiteren sahelo-saharischen Gürtels als Rekrutierungs- und Operationsgebiet. Marokkanische Staatsangehörige im Allgemeinen – darunter auch potenziell Personen aus der Westsahara – waren in der Vergangenheit jedoch in signifikanter Zahl an jihadistischen Konflikten in Syrien, Irak oder der Sahelzone beteiligt, und Rabat hat mehrfach auf die Herausforderung zurückkehrender Kämpfer und radikalisierter Personen hingewiesen. Vor diesem Hintergrund ist für die Westsahara eher von einer indirekten Gefährdung durch marokkanische oder sahelo-saharische Rückkehrer auszugehen, die in anderen Landesteilen oder Nachbarländern verankert sind, aber grenzüberschreitende Infrastrukturen, Schmuggelrouten und lokale Netzwerke nutzen können.

Zwei mutmaßliche Terroristen festgenommen
250917-kolumbien-04