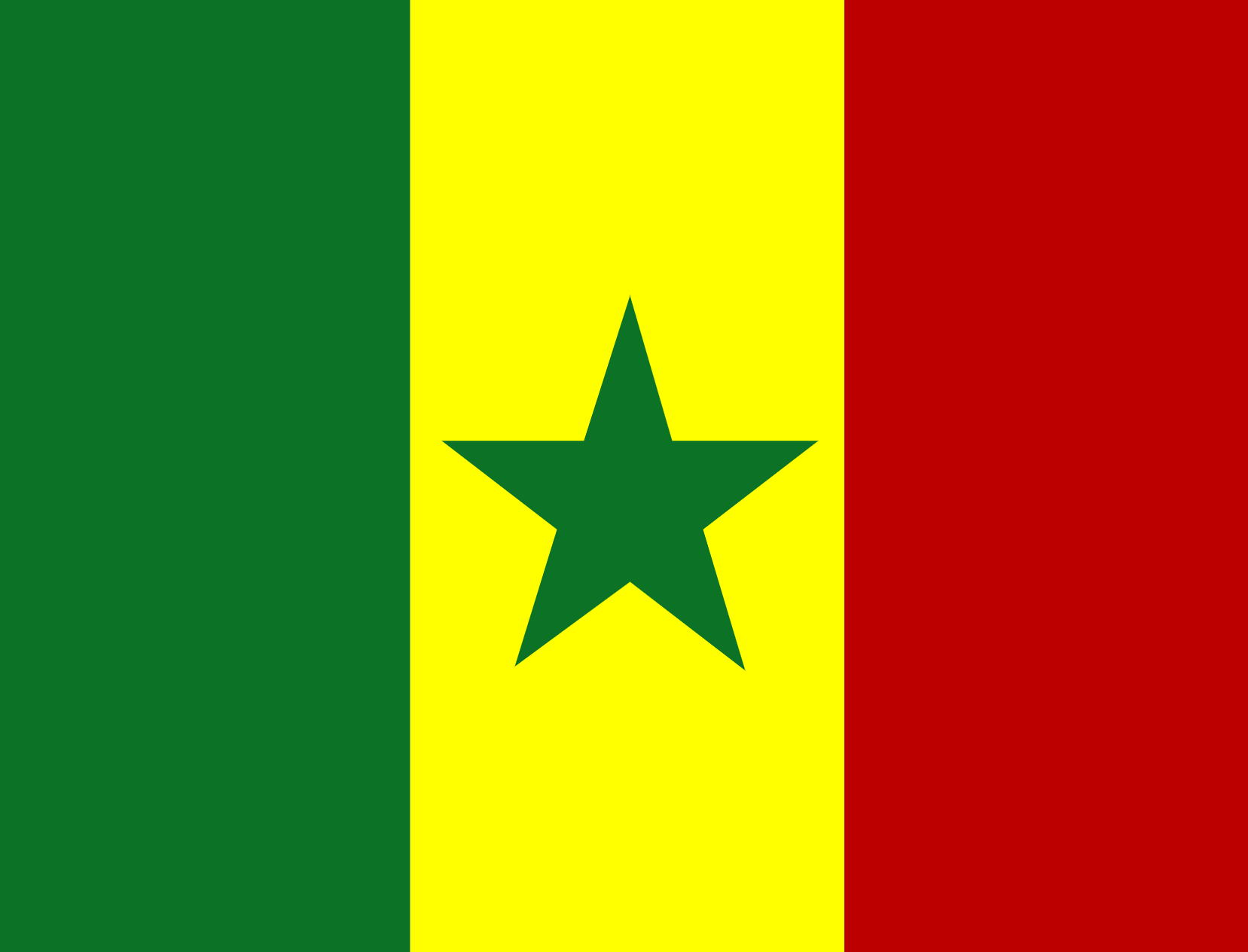
Senegal
Senegal gilt trotz seiner Lage am Rande des Sahel weiterhin als eines der stabileren Länder Westafrikas. Bislang wurden auf senegalesischem Boden keine größeren Terroranschläge verzeichnet, doch die Sicherheitslage ist zunehmend von regionalen Dynamiken geprägt. Die al-Qaida-nahe Gruppierung “Jama’at Nusrat al-Islam wal Muslimin” (JNIM) hat ihre Präsenz in der benachbarten malischen Region Kayes in den vergangenen drei Jahren deutlich ausgebaut und verübt dort vermehrt Angriffe und Blockaden, die auch wirtschaftliche Verbindungen zwischen Dakar und Mali beeinträchtigen. Durch diese Entwicklungen ist Senegal stärker ins Blickfeld militanter Gruppen geraten.
Die senegalesische Regierung hat als Reaktion ihre Sicherheitsarchitektur seit 2024 spürbar verstärkt. Neben intensivierten Grenzpatrouillen, die teils gemeinsam mit Mali durchgeführt werden, hat das Land auch die Kooperation mit internationalen Partnern wie der EU, den USA, Kanada, Frankreich, Mauritanien und den Vereinten Nationen ausgebaut. Schwerpunkt ist der Informationsaustausch, die Verbesserung der Nachrichtendienste sowie die Ausbildung der Sicherheitskräfte. Im Frühjahr 2025 wurde in Dakar eine nationale Roadmap vorgestellt, die den Schutz besonders verwundbarer Ziele wie Hotels, Restaurants, touristische Einrichtungen und religiöse Stätten in den Mittelpunkt stellt.
Die unmittelbare Gefahr groß angelegter Anschläge in Dakar wird derzeit als gering eingeschätzt. Gleichwohl können Einzelattacken oder gezielte Übergriffe gegen westliche Einrichtungen, Orte mit hoher Ausländerpräsenz oder symbolträchtige Ziele nicht ausgeschlossen werden. In den Grenzregionen zu Mali und Mauretanien ist das Risiko höher, da poröse Grenzen, schwache Infrastruktur und sozioökonomische Belastungen Milizen dort Handlungsräume eröffnen. Separatistische Gruppen im südlichen Casamance-Gebiet greifen zwar weiterhin punktuell auf terroristische Taktiken zurück, ihre Aktivitäten bleiben jedoch regional begrenzt und ohne internationale Dimension.
Insgesamt wird das Terrorismusrisiko für Senegal im August 2025 als niedrig bis moderat eingestuft. Stabilität, soziale Kohäsion und eine Tradition des moderaten Islam wirken destabilisierenden Einflüssen entgegen, während die Sicherheitskräfte durch internationale Unterstützung zunehmend professionalisiert werden. Schwachstellen bestehen jedoch bei der Notfall- und Katastrophenreaktion, die außerhalb Dakars nur eingeschränkt funktionsfähig ist. Ob sich die Bedrohungslage in den kommenden Monaten verschärft, hängt maßgeblich von der weiteren Entwicklung im Sahel ab und davon, ob es militanten Gruppen gelingt, ihre Aktivitäten nachhaltig auf senegalesisches Territorium auszudehnen.
Jihadistische Aktivitäten im Maghreb und Westafrika
Im Juli 2025 wurde in Westafrika ein Rückgang der registrierten jihadistischen Anschläge verzeichnet, mit insgesamt 101 Angriffen, die etwa 570 Todesopfer forderten – vor allem Zivilisten, Sicherheitskräfte und Mitglieder lokaler Milizen. Dieser Rückgang sollte jedoch nicht als Nachlassen der Bedrohung interpretiert werden, sondern als strategische und taktische Umorientierung der Gruppen in der Region.
Die Gruppe “Jamaat Nusrat al-Islam wal-Muslimin” (JNIM) bleibt der dominierende Akteur und ist für über 60 % der Angriffe verantwortlich, insbesondere in Burkina Faso, Mali, Niger und Togo. Die Angriffe umfassen Hinterhalte, Sprengfallen (IEDs), Schusswechsel und gezielte Tötungen, mit einem hohen Anteil ziviler Opfer. Parallel intensiviert der “Islamische Staat in Westafrika” (IS-WA) zusammen mit seiner nigerianischen Niederlassung seine Aktivitäten in Niger, Nigeria, Tschad und Kamerun, wobei der Schwerpunkt auf Angriffen gegen Zivilisten liegt.
Im Maghreb war die jihadistische Aktivität im Juli begrenzt, jedoch gab es vereinzelte Vorfälle in Algerien und Libyen. In Algerien übergaben zwei Mitglieder von AQMI sich freiwillig an das Militär, während in Libyen drei IS-nahe Zellen im Süden des Landes durch Geheimdienste neutralisiert wurden. Diese Zellen waren in Rekrutierung, Menschenhandel und Geldwäsche aktiv, was auf eine fortbestehende Präsenz jihadistischer Netzwerke hinweist.
Ein wichtiger politischer Schritt war die Konsolidierung der Sahel-Staaten-Allianz (AES) durch einen Vertrag, der eine Verteidigungs- und Unterstützungsgemeinschaft begründet. Dies könnte Spannungen mit der Wirtschaftsgemeinschaft westafrikanischer Staaten (ECOWAS) erzeugen und Länder wie Ghana oder die Elfenbeinküste isolieren, wodurch Instabilität begünstigt wird.
JNIM verlagert seine Aktivitäten zudem strategisch nach Süden und Westen in Mali und Burkina Faso, mit koordinierten Hinterhalten nahe der Grenze zu Senegal und zunehmender territorialer Kontrolle. Dies erhöht das Risiko einer Ausbreitung von Gewalt auf Mauritanien, Guinea und Senegal.
