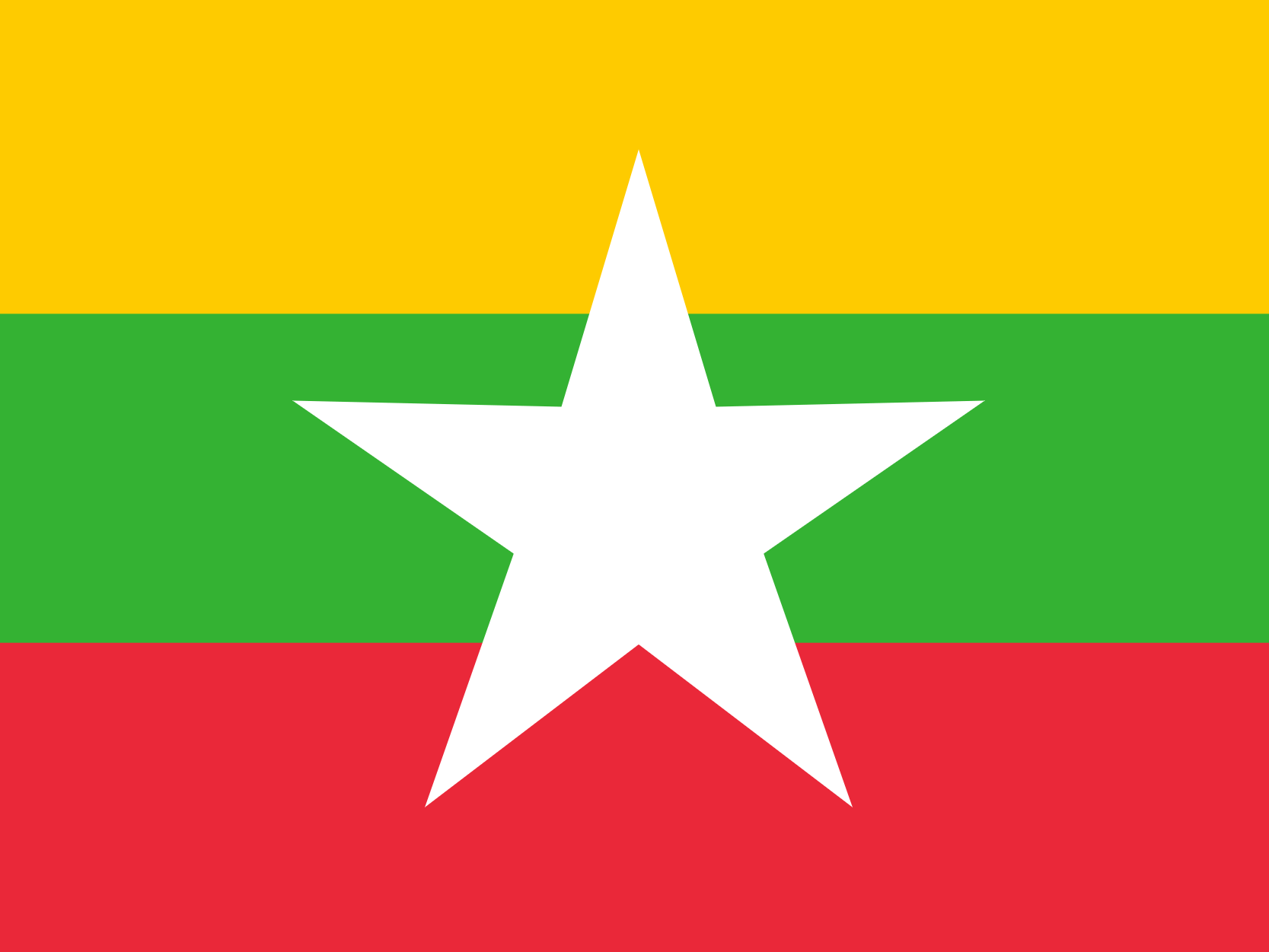
Myanmar
Myanmar befindet sich seit seiner Unabhängigkeit in einem Zustand anhaltender innerstaatlicher Aufstände. Das Terrorrisiko im Land geht dabei in erster Linie von inländischen bewaffneten Gruppen aus, die sowohl politische als auch ethnische Ziele verfolgen. Während islamistischer Extremismus nur eine sehr begrenzte Rolle spielt, haben sich die inneren Konflikte in den letzten Jahren deutlich verschärft, insbesondere seit dem Militärputsch im Februar 2021.
Historisch gesehen ging die Terrorgefahr in Myanmar vor allem von ethnischen Rebellengruppen aus, die seit Jahrzehnten im Konflikt mit dem Staat stehen. Diese Gruppen setzten Sprengstoffanschläge gegen staatliche und militärische Ziele ein, insbesondere in den Grenzregionen der Shan- und Kachin-Staaten. Ziel dieser Attacken waren meist Symbole der Regierung und der Militärjunta, also Kasernen, Verwaltungsgebäude oder andere Einrichtungen der staatlichen Infrastruktur.
Nach dem Staatsstreich im Februar 2021 nahm die Zahl der Anschläge landesweit stark zu, auch in großen Städten wie Yangon, Mandalay und Naypyidaw. Anti-Junta-Gruppen, die der prodemokratischen National Unity Government (NUG) nahestehen – darunter die People’s Defence Forces (PDF) – verübten Bombenanschläge auf militärische und staatliche Einrichtungen und führten gezielte Attentate auf Mitglieder des Regimes durch.
Mehrere ethnische bewaffnete Organisationen (EAOs) lehnten Friedensverhandlungen mit der Militärregierung ab und gingen lose Allianzen mit den PDFs ein. Diese Gruppen zielen in der Regel auf militärische und politische Gegner, greifen jedoch gelegentlich auch Unternehmen oder Personen an, die mit dem Regime kooperieren oder sich nicht an der zivilen Ungehorsamsbewegung beteiligen.
In den vergangenen zwei Jahrzehnten wurden zahlreiche Anschläge auf Sicherheitskräfte und militärische Einrichtungen verübt. Besonders in Rakhine State führten Rakhine-Separatisten, darunter Mitglieder des Arakan National Council (ANC) und der Arakan Army (AA), Bombenangriffe auf Regierungsinfrastruktur durch.
Auch die Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA), ehemals Harakah al-Yaqin, griff regelmäßig Polizeiposten und Grenzstationen in Buthidaung, Maungdaw und Rathedaung an.
Seit dem Putsch 2021 wurden landesweit über 300 Bombenanschläge durch oppositionelle Kräfte registriert, auch in städtischen Gebieten. Dazu zählen unter anderem ein Raketenangriff auf den Luftwaffenstützpunkt Mingaladon bei Yangon im April 2023 sowie Sprengstoffanschläge während der Thingyan-Festlichkeiten in Yangon und Mandalay. Die Ziele solcher Angriffe sind in der Regel Soldaten, Polizisten, lokale Regierungsvertreter und Unterstützer des Militärregimes.
Myanmar stand bislang nicht im Zentrum internationaler dschihadistischer Aktivitäten. Dennoch besteht ein langfristiges Risiko, dass islamistische Extremisten aus benachbarten Ländern wie Thailand oder Bangladesch Einfluss gewinnen könnten. Die anhaltende Verfolgung der muslimischen Rohingya-Minderheit in Rakhine State bietet solchen Gruppen potenziell ein ideologisches Narrativ für Rekrutierung und Legitimation.
Im Jahr 2020 stufte die Militärregierung sowohl die Arakan Army (AA) als auch die Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA) als terroristische Organisationen ein. Während die AA später wieder von der Liste gestrichen wurde, dauern die Kämpfe zwischen beiden Seiten an. Die ARSA gilt weiterhin als potenzielle Bedrohung, insbesondere im Grenzgebiet zu Bangladesch, wo sie möglicherweise Unterstützung und Ausbildung aus dem Ausland erhielt.
Trotz der genannten Gefahren bleibt der Einfluss islamistischer Gruppen in Myanmar derzeit gering, da militärische Operationen deren Ausbreitung weitgehend unterbinden.
Im Zuge der eskalierenden Kämpfe zwischen der Militärjunta und den Widerstandsgruppen verschärfte die Regierung ihre Anti-Terror-Gesetze erheblich. Personen mit Verbindungen zur National Unity Government (NUG) oder den People’s Defence Forces (PDF) werden seither offiziell als „Terroristen“ eingestuft. Diese Maßnahmen führten allerdings vor allem zur Verfolgung tausender Zivilisten und erschweren eine klare Abgrenzung zwischen tatsächlichem Terrorismus und politischer Opposition.
Wie US-Luftschläge im Jemen die Huthis gestärkt haben
Nach dem Ende der US-Militärkampagne gegen die Huthis am 6. Mai 2025 erklärte US-Präsident Donald Trump, die Gruppe habe „kapituliert“. Tatsächlich ist der Rückzug der USA jedoch ebenso sehr ein Eingeständnis des Scheiterns der Mission wie Ausdruck der Zurückhaltung, sich in einen noch tieferen Konflikt hineinziehen zu lassen.
Die USA begannen im Dezember 2023 mit Angriffen auf die bewaffnete Gruppe, um die Huthi-Angriffe im Roten Meer zu stoppen, die zwei Monate zuvor als Reaktion auf Israels Militäreinsatz im Gazastreifen begonnen hatten. Diese Angriffe führten dazu, dass der kommerzielle Schiffsverkehr durch den Suezkanal um 60–70 % zurückging.
Oberflächlich betrachtet scheinen die verstärkten US-Luftschläge zunächst erfolgreich gewesen zu sein, da die Huthi-Angriffe seit März weitgehend ausblieben. Doch dieser taktische Erfolg brachte keine strategischen Fortschritte: Trotz der massiven Angriffe konnten die Huthis weiterhin US-Ziele und Israel attackieren, und der Handelsschiffsverkehr hat sich bislang nicht spürbar erholt. Zudem nutzten die Huthis die US-Kampagne, um ihre Kontrolle im Inland zu festigen und feiern den US-Rückzug nun als eigenen Sieg. Ein ranghoher Huthi-Vertreter, Mohammed Abdul Salam, erklärte, Amerika habe „nachgegeben“.
Um die Schifffahrtsrouten im Roten Meer wiederherzustellen, müssen europäische und amerikanische Partner an einer nachhaltigen Lösung arbeiten. Es braucht Druck auf die Huthis, aber auch einen neuen politischen Prozess für den Jemen und die Behebung der akuten staatlichen Defizite des Landes. Nur so lässt sich die Machtbasis der Huthis schwächen und ihre militanten Aktivitäten eindämmen.
Innere Spannungen
Die Huthis kamen 2014 mit Gewalt an die Macht, übernahmen die Kontrolle über die Hauptstadt Sanaa und lösten einen siebenjährigen Bürgerkrieg aus, der zu einer der schlimmsten humanitären Katastrophen der Welt führte – mit über 100.000 Todesopfern. Das Land ist seither faktisch geteilt: Der Norden und Westen stehen unter Kontrolle der Huthis, der Süden, Osten und Teile des Zentrums werden von der international anerkannten, aber zersplitterten Regierung in Aden verwaltet.
Trotz militärischer Überlegenheit und Kontrolle über mindestens 60 % der Bevölkerung fehlt den Huthis nationale Legitimität. Sie lehnten eine inklusive politische Lösung ab und scheiterten an der Bereitstellung grundlegender staatlicher Dienstleistungen. Die Bevölkerung leidet unter hohen Steuern, ausbleibenden Gehältern im öffentlichen Dienst und mangelhafter Versorgung mit Lebensmitteln und sauberem Wasser.
Im Dezember 2023 setzte das Welternährungsprogramm (WFP) seine humanitäre Hilfe für sechs Monate aus, da die Huthis die Verteilung für eigene Zwecke missbrauchten und bevorzugt Kämpferfamilien bedachten. Nach Wiederaufnahme der Hilfe erreichte das WFP nur noch 6,5 Millionen Menschen statt zuvor 9 Millionen.
Diese Missstände führten zu wachsendem Unmut und Protesten in Huthi-Gebieten. Im März 2023 kam es nach dem Tod eines Huthi-Kritikers in Haft zu Massenprotesten, und auch landesweite Feiertage wurden zum Anlass für Demonstrationen gegen die Gruppe, die mit Verhaftungswellen reagierte. Besonders nach dem von der UNO vermittelten Waffenstillstand im April 2022, der den ersten landesweiten Frieden seit sieben Jahren brachte, wurden die Regierungsdefizite der Huthis deutlich sichtbar. Dies schwächte ihre zuvor große interne Geschlossenheit, und Machtkämpfe zwischen führenden Huthi-Figuren wie Mohammed Ali al-Huthi und Ahmed Hamid traten offen zutage.
Wie die Huthis den Gaza-Krieg und US-Angriffe ausnutzten
Der Krieg in Gaza und die westlichen Gegenangriffe im Roten Meer boten den Huthi-Anführern die Möglichkeit, ihre Macht zu festigen. Die Gruppe nutzte die Situation, um die Bevölkerung in Kriegsbereitschaft zu halten, ihre ideologische Legitimation zu erneuern und Kritik an ihrer Regierungsführung zu unterdrücken.
Die Huthis unterstützten offen die Hamas-Operation gegen Israel im Oktober 2023 und starteten ihre eigene Kampagne „Schlacht der verheißenen Eroberung“ zur Unterstützung Gazas, zu der auch die Angriffe im Roten Meer gehörten. Im Inland intensivierten sie ihre religiöse und ideologische Propaganda, etwa durch Radiosendungen, Schulprogramme und regelmäßige Ansprachen ihres Anführers Abdulmalik al-Huthi, der immer wieder den „göttlichen Sieg“ beschwor. Siege gegen überlegene Gegner wie die saudisch geführte Koalition, die USA oder Israel werden als Beweis für diese göttliche Legitimität dargestellt.
Doch die Huthis setzten nicht nur auf Ideologie: Sie nutzten den Gaza-Krieg auch zur massiven militärischen Mobilisierung. Kurz nach Beginn der Krise starteten sie zweiwöchige Militärübungen, an denen im Dezember 2023 rund 16.000 Rekruten teilnahmen – ein Rekordwert, der ihre Absicht unterstreicht, die Gesellschaft weiter zu militarisieren.
Diese Machtkonsolidierung zeigte sich auch in der Regierungsstruktur: Im August 2024 installierten die Huthis eine ausschließlich aus eigenen Mitgliedern bestehende Regierung und schafften die richterliche Unabhängigkeit ab. Im Sommer 2024 häuften sich Festnahmen von UN- und NGO-Mitarbeitern, die in inszenierten Geständnissen für die Probleme des Landes verantwortlich gemacht wurden.
Die US-geführten Luftschläge verstärkten paradoxerweise diese Dynamik noch. Die Huthis sind es gewohnt, äußeren Druck zu widerstehen, und verfügen über eigene sowie iranisch unterstützte militärische Fähigkeiten. Trotz der Angriffe konnten sie weiterhin US-Schiffe attackieren, Drohnen abschießen und sogar Israels Hauptflughafen angreifen. Der US-Rückzug wird nun als weiterer „göttlicher Sieg“ inszeniert.
Jenseits militärischer Maßnahmen
Trotz jahrelanger Militärinterventionen – von der saudischen Invasion 2015 bis zu den aktuellen US-Angriffen – bleiben die Huthis die dominierende Kraft im Jemen. Die US-Luftschläge konnten zwar die Angriffe auf die Schifffahrt vorübergehend eindämmen, haben aber die strukturellen Ursachen für den Aufstieg und Machterhalt der Huthis nicht beseitigt. Im Gegenteil: Sie drohen, den Konflikt zu verlängern und die Huthis weiter zu verankern, wodurch der Spielraum für eine politische Lösung schrumpft.
Militärischer und wirtschaftlicher Druck kann Teil einer Strategie sein, um die Huthis an den Verhandlungstisch zu bringen. Doch ohne politische Perspektive wird dies nicht gelingen. Westliche Staaten, darunter die USA und europäische Länder, sollten daher verstärkt den jemenitischen Staatsaufbau unterstützen und Wege für einen politischen Dialog schaffen, etwa durch gerechtere Verteilung von Staatseinnahmen. Dabei ist enge Zusammenarbeit mit den Golfstaaten, insbesondere Saudi-Arabien, entscheidend.
Auch die international anerkannte Regierung muss dringend reformiert werden, um ihre Legitimität zu stärken: Verfassungsreformen, Aufbau professioneller Sicherheitskräfte, Bekämpfung von Korruption und lokale Verwaltungsreformen sind nötig. Die Golfstaaten könnten zudem mit wirtschaftlichen Anreizen wie Wiederaufbauhilfen und Arbeitsmöglichkeiten für Jemeniten die Attraktivität von Verhandlungen erhöhen.
Um die Angriffe im Roten Meer nachhaltig zu beenden, müssen die USA und ihre europäischen Partner in die Stabilisierung des Jemen investieren. Eine umfassende politische Strategie ist zwar komplexer als rein militärische Ansätze, aber sie ist der einzige Weg zu einer dauerhaften Lösung.
US-Luftangriffe mit wenig Wirkung Gegen Huthi
Das Ergenis der Angriffe der US-Luftwaffe auf EInrichtungen der Huthi im Jemen sind aus US-Sicht weniger überzeugend als erwartet. Die Rebellen haben zwar einige hochrangige Funktionäre verloren und wurden Drohnenfabriken der Rebellen zerstört sowie einige Nachschubwege über das Meer aus dem Iran und über Land aus dem Oman unterbrochen, empfindlich getroffen wurde Huthi aber nicht. Bunker und Waffendepots der Miliz hätten US-Angriffen bisher widerstanden. Zudem verfügen die die Huthis über riesige Vorräte an konventionellen Waffen. Zudem reichten den Rebellen schon ein paar Lkw-Ladungen eingeschmuggelter Raketen- und Drohnenteile, um die Angriffe auf die Schifffahrt monatelang fortzusetzen. Bei der US-Marine könnte hingegen bald die Präzisionsmunition knapp werden.
Die Huthis hatten im November 2023 mit Angriffen auf Handels- und Kriegsschiffe im Roten Meer begonnen, um der ebenfalls vom Iran unterstützten Hamas im Krieg gegen Israel zu helfen. Bei Inkrafttreten der Gaza-Waffenruhe am 19. Januar stellten die Huthis das Feuer ein, nahmen die Angriffe im März aber wieder auf, als Israel die Feuerpause beendete.
Bei der Beschaffung ihrer Waffen stützen sich die Huthis auf Lieferungen aus dem Iran, auf Eigenbau und auf eroberte Arsenale der Regierung. Sie haben schätzungsweise 100.000 Kämpfer, die auf einen radikal antiwestlichen Kurs eingeschworen sind. „Gott ist groß, Tod den USA, Tod den Israelis, verflucht seien die Juden, der Islam soll siegen“, lautet ihr Motto.
Auch politisch profitieren die Huthis von US-Militärschlägen. Ihr Fanatismus machte die schiitischen Rebellen in den vergangenen Jahren bei vielen Jemeniten unbeliebt, doch ihr Widerstand gegen die Weltmacht USA verbessert ihr Image. Die USA seien in den Augen vieler Jemeniten der Aggressor. So können die Huthis jetzt mehr neue Kämpfer anwerben als vor der Konfrontation mit den Amerikanern. Ohne einen Großangriff mit Bodentruppen, um die Huthis aus Sanaa und anderen Landesteilen zu vertreiben, dürften die Rebellen nicht zu beeindrucken sein.
